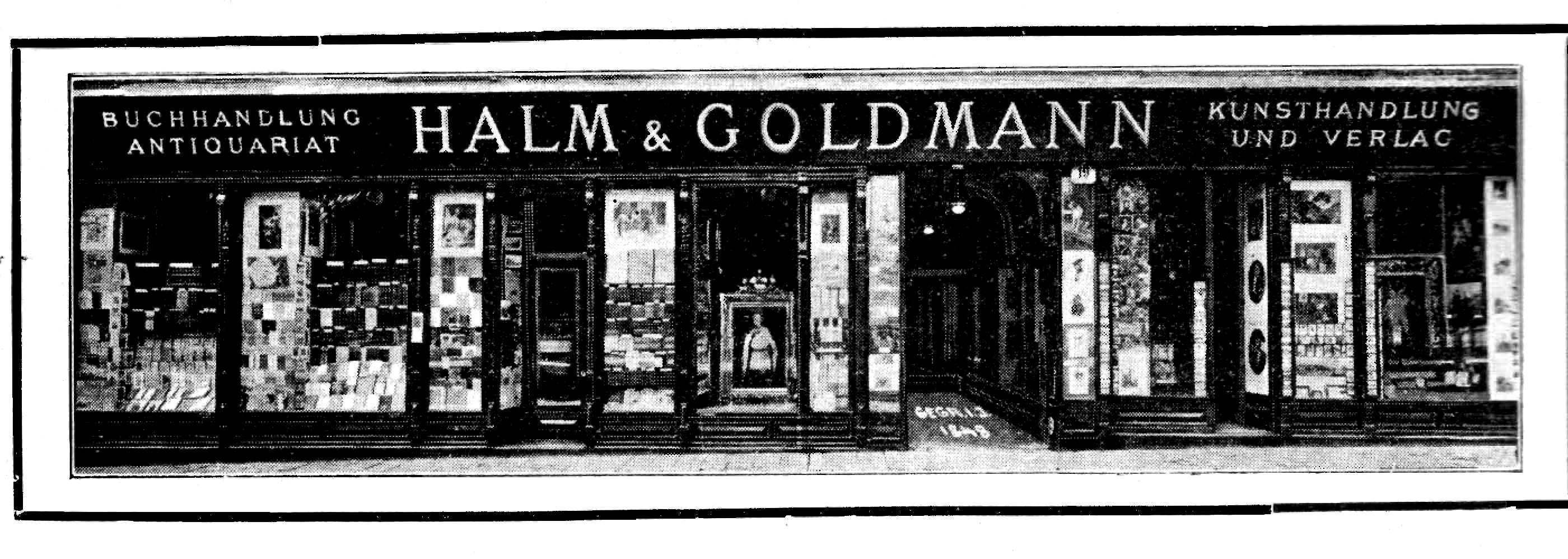I. Entwicklung des Verlagsbuchhandels in Österreich bis 1918
- 1. Historischer Abriß
- 2. Behinderungen in der Entwicklung vor 1918
- 3. Allgemeine Entwicklung des Verlags bis 1918
- 4. Die Verlagslandschaft in Österreich vor 1918
- a) Artaria & Co
- b) Anton Schroll & Co. (L.W. Seidel)
- c) Verlag Ed. Strache
- d) Wilhelm Braumüller
- e) Verlag Franz Deuticke
- f) Wilhelm Frick
- g) Universal-Edition A.G.
- h) Styria (Meyerhoff, Moser)
- i) Manz (Rhombus A.G.)
- j) Ed. Hölzel
- k) Urban & Schwarzenberg
- l) Verlag der Wiener Volksbuchhandlung
- m) Moritz Perles
- n) Gerlach & Wiedling
- o) Carl Fromme
- p) Robert Mohr
- q) Halm & Goldmann
- r) Wiener Verlag
- Ergänzungen zur Buchveröffentlichung von 1985
1. Historischer Abriß
Die Entwicklung und die „Geschichte“ des Verlagswesens zeigt eine Verschwisterung zwischen Buchdrucker und Buchhändler bzw. Sortimenter. Carl Junker stellt in seinem Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Buchhandels in Österreich fünf verschiedene Perioden fest.[1] Mit seinen vielen Klöstern war Österreich vornehmlich eine wichtige Stätte des Handschriftenhandels. Noch im Mittelalter, ein Jahrhundert vor der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg, war 1365 die Wiener Universität von Rudolf dem Stifter gegründet worden. Sie entwickelte sich im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte zu einer bedeutenden Stätte neuzeitlichen Wissens und sollte dann eine „Schaltstelle“ in der Verbreitung des Buchhandels werden. Die ersten gedruckten Bücher sind relativ spät nach Österreich gelangt. Der Abt von Sankt Florian soll im Jahre 1472 als erster hier ein gedrucktes Buch gekauft haben. Zehn Jahre später hat dann ein nicht gdenannter Drucker mehrere Kleindrucke (eines Wörterbuchs, einer Rochuslegende, und neun weiterer Schriften) verlegt, womit die Feier im Jahre 1982 von „500 Jahre Druck in Österreich“ einigermaßen begründet erscheint.[2] Diese Drucke stellten zwar die frühesten einwandfrei nachgewiesenen Produkte des österreichischen graphischen Gewerbes dar, aber von einem „Verlag“ im heutigen Sinn war man noch weit entfernt.
Ende des 15. Jahrhunderts oder Anfang des 16. wurde von den Gebrüdern Allantsee aus Bayern gegenüber dem Stephansdom ein Verlagshaus, „das bald die ganze damalige Welt, soweit sie für das Geistige Interesse hatte, umspann“ (Junker, ebenda, S. 7) gegründet. Sowohl der Wiener als auch der österreichische Buchhandel waren Anfang des 16. Jahrhunderts noch ziemlich abgeschnitten. Er beschränkte sich noch fast nur auf die Residenzstadt und auf einige fahrende Buchführer.
Junker bezeichnet die zweite Periode als „die dunkelste Zeit“: „fast hundert Jahre hören wir von einem Buchhandel in Wien und Österreich, soweit er nicht von den inländischen Buchdruckern ausging, fast nichts.“ (Junker, ebenda, S. 8). Der Entwurf einer Buchhändlerordnung aus dem Jahre 1578 ist zwar überliefert, doch ist es ungewiß, ob sie je in Kraft getreten ist. Nach einiger Unklarheit wurde in einem Dekret des Jahres 1628 erklärt, daß nun beide Gewerbe – Buchhandel und Buchdruck – der Wiener Universität unterstünden. Im Jahre 1698 schließlich starb Johann Gottfried Bößkraut, der Inhaber der ältesten Wiener Buchhandlung. In Wien an der Wende zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert, einer Stadt, die nur etwas mehr als 100.000 Einwohner hatte, fand man acht Buchdrucker, die in der Regel auch „Verleger“ waren, und sechs Buchhandlungen. Mit der Errichtung des neuen Gebäudes der Hofbibliothek im Jahre 1726 durch Kaiser Karl VI. registrierte man einen merkbaren Aufschwung im Buchgewerbe.
Wien zählte zwar zu den ältesten Druckorten im deutschen Sprachraum, aber es wird allgemein die Meinung vertreten, daß man eigentlich erst seit der Zeit Maria Theresias von einem österreichischen Verlag sprechen kann. Und mit ihrer Regierungszeit beginnt nach Junker die dritte Periode in der Entwicklung des Verlagsbuchhandels in Österreich. Unter ihrer Herrschaft wurde nämlich die „Ordnung für die Buchhändler in den kaiserl. königl. Erblanden vom 28. März 1772“ publiziert. Dieser Ordnung ging eine Reihe von kleinen Schritten hinsichtlich der Verleihung von Buchhändlerkonzessionen voraus. Bis 1755 konnte nur die Wiener Universität bestimmen, wieviele Buchhandlungen es geben sollte und wem eine Konzession verliehen werden durfte. Ab diesem Jahr durfte die Universität die Zahl der Buchhandlungen in Wien künftig nicht mehr ohne kaiserliche Bewilligung erhöhen. Dieses Hofdekret hatte zur Folge, daß die Universität somit nur mehr das Recht hatte, die Übertragung von Buchhandlungsbefugnissen zu gestatten. Eine Resolution der Kaiserin im September 1771 besagte, daß künftig die Buchhandlungsfreiheiten lediglich durch die „Kommerzialkonzesse“ und in wichtigen Fällen nur mit Bewilligung des Kommerzialhofrates erteilt werden durften. Gleichzeitig befahl die Kaiserin die Ausarbeitung der vorhin erwähnten Buchhändlerordnung.
Maßgebend für die Entwicklung des Verlagsbuchhandels noch zu einer Zeit, wo es den reinen „Verleger“ im späteren Sinne offenbar nicht gab, war der 7. Punkt der kaiserlichen Ordnung:
7mo Die Buchhändler können mit allen Gattungen der Bücher, außer den verbothenen, folglich mit gebundenen, und ungebundenen, alten, und neuen, einzeln Kupferstichen, und Landkarten, so wie mit dergleichen ganzen Werken Verkehr, und Handel treiben, auch selbst Bücher verlegen und von anderen erkaufen. (…)[3]
Nur: Den konzessionierten „Bücherkrämern“, die den „Handel mit allen gebundenen Büchern“ trieben, war der „Verlag neuer Bücher“ nicht erlaubt.
Die Zahl der Buchhändler, die „auch selbst Bücher verlegen“ konnten, blieb sehr beschränkt und durfte sogar „ohne Noth“ nicht vermehrt werden. Der einzige andere Bezug zum „Verleger“ in dieser Ordnung betrifft eine Art von „copyright“, vom ausschließlichen Recht, dieses oder jenes Buch zu verlegen:
10mo Den Buchhändlern stehet bevor, für die in Verlag nehmende Bücher Privilegia impressoria anzusuchen, nach deren Erhaltung keinem Buchhändler in den kaiserl. königl. Erblanden gestattet ist, ein solches Buch während der Dauer des Privilegii mit oder ohne Zusätzen wieder aufzulegen, oder einige Exemplare von einer fremden, oder anderen erbländischen Auflage zu führen, bey Confiscations- und der in dem Privilegio enthaltenen Strafe. (a.a.O.)
Der neue, freie Geist setzte sich in der kurzen Regierungszeit von Kaiser Joseph II. fort. Nun wurden die Verhältnisse im Wiener Buchhandel grundlegend verändert. Ein Meilenstein in dieser Hinsicht war das Zensurpatent vom 11. Juni 1781. Durch die Freigabe der Presse, der Buchdruckerei und des Buchhandels und die weitgehende Lockerung der Zensurbestimmungen begann die kurzlebige „Sturm- und Drangperiode“ für den österreichischen Buchhandel. Die josephinischen Reformen fanden aber teils durch den sterbenden Kaiser selbst, teils durch den nach kurzer Regierung seines Bruders Leopold II. nachfolgenden Kaiser Franz rasch ein Ende. Die wenigen etablierten Wiener Buchhändler waren über die alten-neuen Einschränkungen nicht unglücklich, zumal sie in der Freiheit ihren Ruin sahen. Die „Konzessionspflicht“ blieb und bleibt eine der am häufigsten diskutierten Fragen im österreichischen Buchhandel überhaupt. (In Deutschland herrschte Gewerbefreiheit, also keine Konzessionspflicht.)
Junker setzt die vierte Periode mit den Jahren 1806 bis 1860 an. Am 18. März 1806 hatte Kaiser Franz eine Buchhändlerordnung erlassen, die sich nicht wesentlich von jener Maria Theresias aus dem Jahre 1772 unterschied. Dieser Zeitraum, auf den wir in anderem Zusammenhang noch kurz zu sprechen kommen werden, ist mit Ausnahme eines kurzen Zwischenspiels im Jahre 1848 durch Zensur und Repression gekennzeichnet.
Zwei Gesetzeswerke, die (bis heute) einen überragenden Einfluß auf den Verlagsbuchhandel ausübten und die ihn in geordnete Bahnen lenken sollten, wurden in den Jahren 1859 und 1860 herausgegeben. Das erste war die Publikation der neuen Gewerbe-Ordnung (G.O.) am 20. Dezember 1859. Was dem Laien etwas kurios erscheinen mag, ist die Tatsache, daß der Begriff „Verleger“ (und Verlag) nicht ausdrücklich erwähnt wird. Er wurde halb von Gewerbebestimmungen, halb von Preßgesetzen – wie dem vom 17. Dezember 1862 – betroffen. Nach dem Gesetz vom Jahre 1859, das mehrfach novelliert wurde, gehörte der „Verlag“ – ohne erwähnt zu sein – neben Buchhandlungen einschließlich Antiquarhandlungen, Kunst- und Musikalienhandlungen gemäß § 15,1 zu den konzessionierten Gewerben. Zum Antritte eines solchen konzessionierten Gewerbes wurde – mit Beziehung auf das betreffende Gewerbe – „eine besondere Befähigung“ gefordert. Überdies war „auf die Lokalverhältnisse Bedacht zu nehmen“, d.h. auf den Lokalbedarf nach einem (weiteren) Gewerbetreibenden. Vom Standpunkt der Konzession also war der Verlag einfach ein untergeordnetes Glied des Buchhandels in Österreich, daher der häufige Begriff „Verlagsbuchhandel“, „Verlagsbuchhandlung“. Daß der Verlag auch konzessionsmäßig nichts Eigenständiges, also nicht eine eigene Sparte darstellte, geht (bis heute) aus dem Namen der im Jahre 1859 gegründeten Standesvertretung, des „Vereins der österreichischen Buchhändler“, wie aus dem Namen von dessen offiziellem Organ: Buchhändler-Correspondenz, hervor.
Obwohl wir auf die Hemmnisse in der Entwicklung des Verlagswesens in Österreich, zumindest der belletristischen Verlage, gleich zurückkommen werden, soll – da wir gerade die entscheidenden Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung zitiert haben – auf ein kurioses Faktum hingewiesen werden. Man bemühte sich ganz allgemein aus geschäftlichen Gründen sicherlich zu Recht, Konzessionen wie einen Schatz zu hüten und Vermehrungen tunlichst zu vermeiden. Im Fall des reinen Verlags, genauer gesagt des Betriebs eines Verlags mit Ausschluß des offenen Ladengeschäfts bzw. des „Gassenlokals“, durch den keinerlei Konkurrenz für Sortimentsbuchhandlungen entstand, war die Verleihung einer Konzession auch in dieser beschränkten Art dennoch unsinnigerweise an die Klausel „Lokalbedarf“ gebunden. Selbst in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Anträge auf Verleihung einer Verlagskonzession mit Ausschluß des offenen Ladengeschäfts von der Korporation der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhändler mit der Begründung glattweg abgelehnt, es wäre etwa in derselben Umgebung ein Verlag mit derselben beschränkten Konzession vorhanden. Erst durch eine Berufung bei der höchsten Instanz, dem BM für Handel und Verkehr, kam der Antragsteller in den Besitz der begehrten Konzession. Zu viele reine Sortimentsbuchhandlungen waren besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für die ganze Buchhandelsbranche gewiß schädlich. Aber auch Verlagskonzessionen wurden von Buchhändlern vergeben, da sie in den entscheidenden Gremien saßen. Diese Praxis des „Hütens“ war einer von mehreren Hemmschuhen in der Entwicklung des Verlagswesens in Österreich.
Junker setzt schließlich den Beginn der fünften Periode mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Werden der Republik Österreich gleich. Also mit dem Jahre 1918.
2. Behinderungen in der Entwicklung vor 1918
Bevor wir die Bedingungen für die Entwicklung und Entfaltung des belletristischen Verlags in Österreich nach 1918 analysieren und die „Blüte“ verständlich machen können, müssen wir uns zuerst mit den Produktions- und Marktbedingungen bis zu diesem Zeitpunkt auseinandersetzen.
In der spärlichen Literatur zur Geschichte des österreichischen Verlagsbuchhandels trifft man immer wieder auf die Feststellung, daß es weder in Wien noch in Österreich allgemein vor 1918 überhaupt je einen namhaften belletristischen Verlag gegeben habe.[4] Aus einem anderen Blickwinkel formuliert: „Eine auch nur flüchtige Beobachtung zeigt, daß der deutsche Verlagsbuchhandel zu einem wesentlichen Großteil von Werken österreichischer Autoren lebt.“ [5]
a) Verlag, Urheberrecht und Berner Convention
Das führt naturgemäß zu Überlegungen hinsichtlich der Ursachen hiefür, und diese erhellen überhaupt die allgemeine Entwicklung des Verlagsbuchhandels in Österreich. Warum haben österreichische Autoren des 19. Jahrhunderts, die heute als „Klassiker“ der österreichischen Literatur gelten, von der jüngeren Generation um die Jahrhundertwende ganz zu schweigen, ihre Werke fast ausschließlich in Deutschland publiziert? Zum Beispiel waren die Werke von Österreichs größtem Dichter des 19. Jahrhunderts, Franz Grillparzer, bis zum Ablauf der Schutzfrist nur durch Cotta in Stuttgart zu beziehen. Aber auch Lenau, Ferdinand von Saar (Weiß: Heidelberg), Peter Rosegger, Ludwig Anzengruber (Cotta: Stuttgart), Anastasius Grün (Cotta: Stuttgart), Marie von Ebner-Eschenbach (Stuttgart), Enrica von Handel-Mazzetti (Paetel: Berlin), Adalbert Stifter (Heckenast: Budapest), u.v.a. zog es ins Ausland. Selbst die Werke von Nestroy und Raimund erschienen in deutschen Verlagen. An Namen besteht kein Mangel: Man braucht nur auf die Tatsache hinzuweisen, daß der Berliner S. Fischer Verlag bis 1918 in etwa drei Dutzend österreichische Autoren in seinem Programm hatte und mit diesen ein gutes Geschäft machte.[6]
Die Frage nun, ob sich kein belletristischer Verlag entwickelte, weil die (bedeutenden) Autoren in Deutschland veröffentlichten, oder ob die österreichischen Autoren ihre Werke in Deutschland publizierten, weil in Österreich kein entsprechender belletristischer Verlag existierte, ist müßig. Es scheint ein dialektisches Verhältnis bestanden zu haben. Die Gründe für diesen Zustand scheinen historischer, politischer, literarischer und volkswirtschaftlicher Natur zu sein. Beginnen wir mit dem politischen Aspekt.
Die berechtigte österreichische Zensur war ein Schreckgespenst sowohl für den Autor als auch für den Verleger. Sie hatte eine Nachwirkung auf den geschäftlichen Betrieb der Verleger. „Der österreichische Verleger war ruiniert, wenn mehrere der bei ihm erschienenen Werke verboten wurden. Sein erstes und letztes Absatzgebiet war ja doch immer das eigene Land; auch hätte es die Zensur kaum zugelassen, daß er die von ihr verbotenen Bücher ausführe. Dem Verleger im Reich bedeutete ein österreichischer Zensurstreich nur den Verlust eines Teiles seines Absatzgebietes, nämlich des österreichischen. So wurde naturnotwendig, so lange diese Zensur in Österreich bestand, der österreichische Verlagsbuchhandel niedergehalten, während er sich draußen in den anderen deutschen Staaten bereits kräftig entwickeln konnte. Der Vorsprung, den dadurch der reichsdeutsche Verlagsbuchhandel vor dem österreichischen gewann, konnte bis zur Stunde nicht mehr eingeholt werden.“ [7]
In jener Zeit der kleinlichsten Zensur wurde es zur Gewohnheit, daß österreichische Autoren mit ihren Werken ins benachbarte Deutschland flohen. „Wenn sie schon das Damoklesschwert eines österreichischen Bücherverbotes traf, so blieb ihnen doch noch die Möglichkeit, daß ihre Bücher wenigstens in den anderen deutschen Staaten Verbreitung fanden.“ (ebda.)
Und was wiederum die Wahl des Verlagsorts durch den österreichischen Autor betrifft, so war es nicht nur die Zensur, die Dutzende und Aberdutzende Schriftsteller veranlaßte, ihre Bücher einem reichsdeutschen Verlag anzuvertrauen. Ein bislang wenig berücksichtigter Grund ist die ungünstige Entwicklung der Frage des Urheberrechts in Österreich – und manche sind der Ansicht, daß auch die neueste Regelung des Urheberrechts Anfang der 80er Jahre ebensowenig zufriedenstellend ist. Es soll aber unterstrichen werden, daß die Urheberrechtsfrage unter den vielen Hemmnissen in der Entwicklung des belletristischen Verlags nicht einzig und allein entscheidend, wohl aber ein einleuchtendes Motiv war, literarische Werke nicht in Österreich bzw. Österreich-Ungarn erscheinen zu lassen.
Carl Junker meint in seiner im Jahre 1900 erschienenen Schrift Die Berner Convention zum Schutze der Werke der Litteratur und Kunst und Österreich-Ungarn, nichts in Österreich sei „weniger erbaulich als die Geschichte aller jener Institutionen und Gesetze, welche sich auf die geistige Produktion beziehen“. Er meint ferner, man könne „mit Fug und Recht behaupten, daß kein Staat von der Bedeutung unserer Monarchie seinen geistigen Arbeitern so wenig Schutz im Auslande gesichert hat, wie Österreich-Ungarn“ (ebda., S. 70). Um die „Flucht“ österreichischer Schriftsteller teilweise zu begründen und somit die Ursachen für die Nicht-Existenz namhafter belletristischer Verlage zu erhellen, müssen wir uns mit dem Verhalten der Monarchie bzw. Österreichs in der allgemeinen Entwicklung in der Frage Urheberrecht besonders im Hinblick auf die sog. Berner Convention befassen.
Das erste Urheberrecht in Österreich,[9] eben jenes Gesetz, das die Grundlage des Verhältnisses zwischen Verleger und Autor bildet, existierte in Form eines kaiserlichen Patents vom 19. Oktober 1846. Erlassen wurde das Patent dem Wortlaut nach „zum Schutz des literarischen und artistischen Eigentums gegen unbefugte Veröffentlichung, Nachdruck und Nachbildung“. Das Gesetz hatte im deutschen Sprachgebiet eine Reihe von Vorläufern, so das preußische Gesetz (1837), das bayrische (1840), das braunschweigische (1842), das sächsische (1844) und schließlich das württembergische (1845). Dieser kühne Schritt in Österreich wurde sodann durch die Beschlüsse des Deutschen Bundes und der mit Sardinien geschlossenen Konvention zum Schutz des literarischen und artistischen Eigentums vom 22. Mai 1840 unmittelbar beeinflußt.
Der wohl wichtigste Gedanke in diesem „Autorrechtspatent“ war zweifellos, daß man das Werk als geistiges Eigentum des Urhebers ausdrücklich anerkannte. Dieses Recht war aber zugleich einer Reihe von Beschränkungen unterworfen. Stark beeinträchtigt war das Urheberrecht im Hinblick auf Übersetzungen und dramatische bzw. musikalische Werke. Neben der Reziprozitätsklausel, (also der Bestimmung über gegenseitigem Schutz), enthielt das Gesetz eine – aus späterer Sicht – sehr primitive Regelung bezüglich Übersetzungen. Es verbot die sofortige eigenmächtige Übersetzung eines erschienenen geschützten literarischen Werkes nur in dem Fall auf ein Jahr, als sich der Autor des Originals das Übersetzungsrecht beim Erscheinen des Originals ausdrücklich vorbehalten hatte. Aber nach Ablauf dieses einen Jahres gab das Gesetz von 1846 die Übersetzung unter allen Umständen frei. Von einer Abgeltung der Übersetzungsrechte ist nichts bekannt. Was die öffentliche Aufführung eines dramatischen oder musikalischen Werks betrifft, so stand dem Urheber das ausschließliche Recht zu, aber nur so lang, als das Werk nicht durch den Druck oder Stich veröffentlicht worden war. Man differenzierte, aber „Veröffentlichung“ war nicht immer gleich „Veröffentlichung“. Denn es galt nicht als eine solche Veröffentlichung, wenn der Autor einzelne, in Druck gelegte Exemplare als Manuskript (wie z.B. Schnitzlers Reigen) herausgab und dies ausdrücklich auf dem Exemplar ersichtlich war. So findet man auf älteren Werken den Vermerk: „Den Bühnen gegenüber als Manuskript gedruckt.“ Ende 1858 erfuhr das geltende Gesetz durch die Ministerialverordnung vom 27. Dezember (RGBl. Nr. 6/1859) eine kleine Änderung insofern, als die Beschlüsse der deutschen Bundesversammlung vom 12. März 1857 zur Geltung gelangten. Nunmehr sollte das Recht zur Aufführung eines dramatischen oder musikalischen Werkes durch den Druck und die Verbreitung des Werkes nicht verlorengehen, wenn sich der Urheber das Aufführungsrecht durch einen auf allen Exemplaren befindlichen Vorbehalt gewahrt hatte. Ansonsten herrschte der Rechtszustand des Jahres 1846 in Österreich noch ein weiteres halbes Jahrhundert unverändert.
In der Zwischenzeit hatte sich allerhand Neues entwickelt, doch verpaßte Österreich und später Österreich-Ungarn gänzlich den Zug der Zeit und blieb hinter den internationalen Entwicklungen zurück. Obwohl das Patent vom Jahre 1846 zu dieser Zeit noch ein „Gesetz von anerkanntem Werthe“ war,[10] wurden dessen Mängel bald offenbar. Während z.B. die Photographie 1846 bloß im Keim vorhanden war, entwickelte sie sich bald zu einer neuen Kunstgattung, die völlig ohne urheberrechtlichen Schutz dastand. Aus diesem mangelhaften Schutz heraus erlitten die Kunstdruckereien Einbußen. Nachteile erwuchsen weiters daraus, daß Österreich mit Ungarn kein urheberrechtliches Abkommen abgeschlossen hatte. Schon 1847 gab es die ersten Reformbestrebungen der Wiener Kunst- und Musikalienhändler, doch erwirkten diese keine Änderungen. „Auch spätere Reformbestrebungen 1852 mit Hilfe der Wiener Handelskammer, dann anfangs der Sechziger- und Siebzigerjahre hatten keinen Erfolg.“ (Verein, S. 32). Mitte der 80er Jahre wurde anläßlich der Generalversammlung 1885 der Entschluß gefaßt, eine Kommission zur Ausarbeitung eines den Bedürfnissen der Gegenwart entsprechenden Urheberrechtsgesetzes einzusetzen, um dadurch die Aufmerksamkeit der Regierung auf diese Problematik zu lenken. Eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen war das Resultat: Einführung einer Sachverständigenkommission; unbedingter Schutz der Melodie bei Kompositionen; eine Schutzfrist von 50 Jahren nach dem Tode des Autors, Künstlers oder Komponisten, die auch auf die Aufführungsrechte musikalischer und dramatischer Werke voll anzuwenden sei und nicht nur wie bisher den Nachdruck der Werke verhindern sollte.[11] Schließlich regte man einen verbesserten Schutz bei Übersetzungen an, denn gerade in dieser Frage waren Autoren und Verleger gewohnt, durch die Finger zu schauen. Der Vorschlag sah eine dreijährige Frist für die berechtigten, vom Autor und Verleger bestimmten Erstübersetzungen vor.
b) Das neue Gesetz 1895
Versuche, Reformen in der Gesetzgebung durchzusetzen, bekamen einen leichten Auftrieb, als endlich 1887 ein Übereinkommen zwischen der österreichischen und der ungarischen Regierung zustandekam, das für die Werke der Literatur und Kunst den gegenseitigen Schutz in beiden Reichshälften sicherte. Im Juli 1892 wurde schließlich der Entwurf eines neuen Gesetzes zum Schutz von Werken der Literatur, Kunst und Photographie von der Regierung ins Herrenhaus eingebracht. Es vergingen wiederum weitere drei Jahre, bis das neue Gesetz vom 26. Dezember 1895 am 31. Dezember im Reichsgesetzblatt kundgemacht wurde. Nach Ansicht von Fachleuten bedeutete dieses Gesetz eine weitgehende Besserung der urheberrechtlichen Bedingungen gegenüber dem kaiserlichen Patent von 1846. Geschützt waren nun „die Werke der Litteratur, Kunst und Photographie, weiche im Inlande erschienen sind; ferner solche, deren Urheber österreichische Staatsbürger sind, mag das Werk im In- oder Auslande oder noch gar nicht erschienen sein (§ 1)“. (Junker, Berner Convention, S. 44) Nun sah sich der Gesetzgeber auch veranlaßt, die eigenmächtige Übersetzung geschützter literarischer Werke in erheblichem Maße einzuschränken. Von nun an war es so, daß der dem Original beim Erscheinen beigesetzte Übersetzungsvorbehalt dem Autor des Originals das ausschließliche Recht zur Herausgabe von Übersetzungen für drei Jahre sicherte. Erschien eine autorisierte Übersetzung innerhalb dieser drei Jahre, galt der Schutz noch für weitere fünf Jahre. Nach Ablauf dieser Frist konnten ohne Zustimmung des Urhebers Übersetzungen in dieselbe Sprache veranstaltet werden. Manche Verleger wußten diesen mangelnden Schutz weidlich auszunutzen. Trotz Verbesserungen wurde das Übersetzungsrecht dennoch stiefmütterlich behandelt. Der Autor war nicht a priori geschützt, sondern er mußte sein Recht mittels aufgedrucktem „Vorbehalt“ sicherstellen. Das Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur endigte in der Regel – und im Gegensatz zum Vorschlag der Kommission der Buchhändler Mitte der 80er Jahre nach einer Schutzfrist von 50 Jahren – 30 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Das war alles schön und gut, doch die Sache hatte einen Haken. Solches Recht bestand (und besteht) in der Regel auf Gegenseitigkeit, und damit kommen wir zu einem Punkt im Gesetz des Jahres 1895, der nach übereinstimmender Ansicht der Kritiker „einen wesentlichen Rückschritt, nämlich in jenem des internationalen Rechts“ (Junker), bedeutete. Für diesen Rückschritt gibt es zweierlei Gründe. Zum einen hatte man sich bei der Abfassung des „neuen“ Gesetzes 1895 an ausländischen, d.h. namentlich an deutschen Gesetzen orientiert, aber leider nicht erkannt, daß diese Vorbilder – entscheidend war das deutsche Gesetz vom 11. Juni 1870! selbst schon zum Teil recht veraltet waren. Zum anderen absentierte sich Österreich-Ungarn völlig von der großen internationalen urheberrechtlichen Übereinkunft. Bevor wir auf die Gründe und Auswirkungen des „Rückschritts“ wie auch des mangelnden Schutzes näher eingehen, ein Blick auf die sog. Berner Convention.
c) Exkurs über die Berner Convention[12]
Bestrebungen in Richtung eines internationalen Schutzes des Urheberrechts reichen in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Wesentlich gefördert wurden sie durch die Abhaltung von Schriftstellerkongressen in Brüssel (1858) und Antwerpen (1877), bei denen man sich mit der Frage einer internationalen einheitlichen Regelung des Urheberrechtsgesetzes auseinandersetzte. Ein weiterer Schritt in diese Richtung war die Pariser Weltausstellung im Jahre 1878, mit der gleichzeitig ein Schriftsteller- und Künstlerkongreß stattfand. Schließlich kam es im Jahre 1883 in Bern zur Einberufung einer eigenen Konferenz von Vertretern der beteiligten Kreise zur Beratung eines Planes zur Gründung einer Union für das schriftstellerische Eigentum. Es wurde dabei ein Entwurf beschlossen, der von der schweizerischen Regierung noch im selben Jahr den Regierungen aller zivilisierten Länder übermittelt wurde. Dann lud die schweizerische Regierung zu einer diplomatischen Konferenz am 8. September 1884 nach Bern ein, an der auch Österreich-Ungarn – zum ersten und letzten Mal – vertreten war. Dieser folgte eine zweite diplomatische Konferenz ebenfalls in Bern am 7. September 1885. Auf dieser Konferenz wurde der abzuschließende Unionsvertrag endgültig festgesetzt. Die Regierungen der einzelnen Staaten sollten ihn nun nur annehmen oder ablehnen – wofür sich z.B. Österreich-Ungarn entschied – aber nicht mehr ändern können. Im folgenden Jahr wurde auf der dritten Berner Konferenz am 9. September 1886 die Union tatsächlich eingerichtet. Nach Beendigung der Ratifizierungsprozedur trat die „Berner Convention“ am 5. Dezember 1887 in Kraft. Zu den ersten Unterzeichnern gehörten zehn Staaten: Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Haiti, Italien, Schweiz, Tunis und Liberia.
Grundlage dieses internationalen Urheberrechtsschutzes war die völlige Gegenseitigkeit der Schutzgewährung. jedes Verbandsland war demnach verpflichtet, den dem Verbandsland angehörigen Werken denselben Schutz zu gewähren wie seinen eigenen. Umstritten war die Regelung des Übersetzungsrechtes, aber man kam miteinander schließlich überein, daß den Urhebern das ausschließliche Übersetzungsrecht bis zum Ablauf von zehn Jahren, von der Veröffentlichung des Originalwerkes in einem Verbandsland an, zustehen sollte. Wie erwähnt, hat sich Österreich fast zehn Jahre später dazu durchgerungen, die Schutzfrist von einem auf drei Jahre zu verlängern!
Das Schlußprotokoll des Jahres 1886 sah die regelmäßige Abhaltung von Konferenzen vor, um die Übereinkunft einer Revision zu unterziehen. Die nächste solche Konferenz fand in Paris am 15. April 1896 statt. Statt die hierbei beschlossenen Änderungen im Vertrage selbst zu verarbeiten, wurden die Beschlüsse in drei verschiedenen Texten niedergelegt (Zusatzvertrag, eine Deklaration, die gewisse Bestimmungen der Convention und des Zusatzvertrages erläuterte, sowie eine Reihe von Wünschen für die Zukunft). Die Unterzeichnung von Zusatzvertrag und Deklaration erfolgte am 4. Mai 1896.
Am bedeutendsten unter den Änderungen war die Ausdehnung des Übersetzungsrechts auf die ganze Dauer des Rechts an dem Original unter der Voraussetzung, daß der Urheber innerhalb von 10 Jahren, von der Veröffentlichung des Originals angefangen, in einem Verbandslande eine Übersetzung hat erscheinen lassen. Aber in den kommenden Jahren vergrößerte sich in bezug auf die Schutzausdehnung und durch den Beitritt weiterer Staaten der Abstand zu Österreich-Ungarn zum besonderen Nachteil seiner deutschen Länder. (Auf die Gründe für die ablehnende Haltung haben wir später einzugehen.)
Gemäß dem in Paris gefaßten Beschluß wurde die dritte Revisionskonferenz, die am 14. Oktober 1908 begann, in Berlin abgehalten. Vertreten waren 15 Verbandsstaaten und 19 Nichtverbandsstaaten. In Berlin kam es zum Beschluß einschneidender Änderungen. So wurde der Kreis der geschützten Werke bedeutend erweitert, um Werke der Baukunst, kunstgewerbliche Werke, Photographien, kinematographische Werke usw. miteinzuschließen, das Übersetzungsrecht dem Urheberrecht gleichgestellt, der Zeitungsschutz (Artikelnachdruck!) verstärkt und das Recht der öffentlichen Aufführung von einem Vorbehalt unabhängig gemacht. Der entsprechende Schutz in Österreich war weit zurückgeblieben. Die in Berlin revidierte Fassung der Berner Convention trat am 24. Jahrestag der ersten Übereinkunft am 9. September 1910 in Kraft. Dieser grobe Umriß der Entwicklungsgeschichte der Berner Convention bildet sozusagen den Hintergrund für die Weiterverfolgung der Zustände bzw. der Entwicklung in Österreich.
d) Folgen und Auswirkungen des mangelnden Schutzes
Nach dem Gesetz des Jahres 1895 sollten die urheberrechtlichen Beziehungen Österreichs zum Ausland nur mehr auf dem Wege von Staatsverträgen, also von Einzelverträgen, geregelt werden. Freilich war der für österreichische Autoren (und Komponisten) im Ausland so notwendige Schutz nur dadurch zu erreichen, daß Österreich seinerseits den auswärtigen Urhebern Schutz gewährte. Das Patent von 1846 hatte z.B. alle im Gebiet des Deutschen Bundes erscheinenden literarischen und artistischen Werke geschützt und alle ausländischen Werke nach den Grundsätzen materieller Reziprozität behandelt. Das war aber trotzdem nur in einem sehr kleinen Ausmaß der Fall. Wie war es denn um die Vertragsverhältnisse mit dem Ausland bestellt?
Mit Ungarn hatte Österreich die Übereinkunft zum gegenseitigem Schutz von Autoren, Literatur und Kunst vom 10. Mai 1887 abgeschlossen. Ohne auf den Inhalt des Vertrags näher einzugehen, kann man feststellen, daß die Fragen Übersetzungsrechte und Recht auf öffentliche Aufführung eines musikalischen oder dramatischen Werks in der Fremdsprache nicht zur Zufriedenheit des Urhebers geregelt worden sein können. Das ist etwa am Beispiel Arthur Schnitzlers und des Reigen aus dem Jahre 1912 ersichtlich.[13]
Mit Frankreich stand Österreich in einem problematischen Vertragsverhältnis vom 11. Dezember 1866, dessen Schutz nach Junker geringer war „als jener, den die französischen Gesetze bedingungslos den Fremden“ einräumten. Auch mit Großbritannien bestand ein Staatsvertrag vom 24. April 1893, der laut Junker „an Klarheit viel zu wünschen übrig“ ließ (Berner Convention, S. 71). Der Nachteil: Der Vertrag galt bloß für einen Teil der englischen Kolonien. Nur der Vertrag mit Italien vom 8. Juli 1890 genügte allenfalls den Anforderungen. Der einzige Vertrag, der in den Jahren unmittelbar nach dem neuen österreichischen Urheberrechtsgesetz von 1895 zustandekam, war der mit Deutschland vom 30. Dezember 1899. Der Vertrag lag aber weit mehr im Interesse des Deutschen Reiches als Österreichs. Für Österreich wurde er als „eigentlich bedeutungslos“ betrachtet. Deutschland war nämlich darauf aus, neben seinen durch das Gesetz bestimmten urheberrechtlichen Beziehungen zu Österreich auch solche mit Ungarn festzulegen. Einen ausgedehnteren Schutz genossen österreichische Schriftsteller dennoch nicht. Der Grund dafür lag in der Gegenseitigkeit, genauer: im mangelnden Schutz, den Österreich ausländischen Autoren gewährte.
Zusammenfassend kann man feststellen, daß in der Zeit bis 1900 Österreich mit bloß vier Staaten der Berner Convention einen Vertrag abgeschlossen hatte.
Aber das Grundproblem mit solchen Spezialverträgen bestand darin, daß sie sehr kompliziert, von Land zu Land verschieden waren und nicht mit allen zivilisierten Ländern abgeschlossen wurden. Aus diesen Umständen heraus zieht Junker einen wichtigen Schluß, der uns der Erklärung für die „Flucht“ österreichischer Autoren in reichsdeutsche Verlage einen Schritt näher bringt. Sieht man von den soeben erwähnten „Ausnahmen“ ab, war die Urheberrechtssituation in Österreich nach Junkers Resümee 1900 katastrophal:
Auf der ganzen übrigen Erde ist der österreichische und ungarische Autor vogelfrei; jeder kann ungestraft seine Schriften nachdrucken oder übersetzen, seine Compositionen vervielfältigen und aufführen lassen, seine Kunstwerke nachbilden, ohne ihn für seine geistige Arbeit auch nur in geringsten zu entschädigen. Und gerade unserer Monarchie würde ein besonderer Schutz für die geistige Production nothwendig sein. (Berner Convention, S. 71)
Die katastrophale Situation blieb während der nächsten zwei Jahrzehnte praktisch gleich. Die Folgen dieser Schutzlosigkeit im Auslande waren mannigfach. Die geltende Rechtlosigkeit konnte ohne weiteres in klingende Münze umgewandelt werden – eben durch „legitime“ Raub- und Nachdrucke, durch unbefugte Bearbeitung, durch Übersetzung. Leidtragender war der Urheber, in unserem Fall der österreichische Schriftsteller, der auf diese Weise (weil vogelfrei) um den Ertrag seiner Arbeit gebracht werden konnte. Genauso hart betroffen waren die österreichischen Komponisten, deren Operetten, Lieder, Märsche und Tanzstücke zwar die ganze Welt beherrschten, aber insofern, als sie in Österreich-Ungarn erschienen, sonst nur in denjenigen Staaten Schutz fanden, mit denen Österreich-Ungarn ein Abkommen abgeschlossen hatte (Deutsches Reich, Frankreich, Großbritannien, Italien).
Es gab aber zwei Möglichkeiten des Schutzes und zwar im großen Zusammenhang gesehen, durch den Beitritt Österreichs zur Berner Convention, der bis nach dem Ersten Weltkrieg nie als eine reelle Möglichkeit erschien, oder in Form von „Selbsthilfe“. Der Urheber hatte „aber ein Mittel, sich dagegen zu schützen, indem er sein Werk nicht in seinem Vaterlande, sondern im Auslande erscheinen läßt und sich dadurch unter das bessere Recht und den ausgedehnteren Schutz des fremden Staates stellt. Seine Werke werden aber dann unter fremder Flagge auf den Weltmarkt gebracht, und sein Werk gilt für ein Erzeugnis jenes Landes, in welchem es erschienen ist.“ (Berner Convention, S. 74)
Diese Schutzlosigkeit im Ausland betraf genauso den österreichischen Verleger auf zweifache Weise. Der ihm gewährte geringe Schutz machte ihn auf dem Weltmarkt weniger konkurrenzfähig. Die Möglichkeit, hervorragende Autoren und Werke an den Verlag zu binden, war eben durch den mangelnden Rechtsschutz beeinträchtigt. Auch als Rechtsnachfolger des Urhebers wurde der Verleger durch die Schutzlosigkeit seiner Verlagsartikel materiell geschädigt. Das hiebei angesprochene volkswirtschaftliche Moment ist nicht zu unterschätzen. Junker führte „das Darniederliegen, insbesondere der österreichischen Verlagsindustrie“, zum Teil auf diesen Faktor zurück. Eckardt wiederum zitiert ein konkretes Beispiel für das literarische Verlustgeschäft (a.a.O.) und zeigt, wie der „geistige Export“ zum finanziellen Problem werden konnte:
Der reichsdeutsche Handel (Verlag und Buchhandel) beschäftigt Druckerei, Papierfabrik, Buchbinderei, exportiert Ware, macht sein Geschäft, während Österreich in diesem Fall bloß das Geistige beigestellt hat und – draufzahlt! Dieses schlechte Geschäft machen wir aber mit allen unseren bekannten Schriftstellern, die ihren reichsdeutschen Verlag haben.
Und nun nehme man die Summen, die dem österreichischen Verlagsbuchhandel jährlich gewonnen werden könnten, wenn man nicht nur den Umsatz eines der gelesensten Autoren berücksichtigt, sondern versuchen würde, den der gesamten österreichischen Schriftsteller, deren Bücher in Deutschland verlegt werden, zu verrechnen! (S. 234)
Die bereits vielzitierte Schutzlosigkeit hatte schließlich auch noch vor 1900 zur Folge, daß „auch schon eine Anzahl österreichischer und ungarischer Verleger in Ländern, welche der Berner Convention angehören, Zweigniederlassungen errichtet, um hierdurch ihren Verlagsartikeln den ausländischen und conventionellen Schutz zu verschaffen. Einige haben bereits der Monarchie ganz den Rücken gekehrt und ihre Geschäftsthätigkeit ausschließlich nach dem Auslande verlegt, (…) (Berner Convention, S. 75). Mit anderen Worten: Österreich exportierte bereits zu dieser Zeit nicht nur seine Schriftsteller, sondern auch seine Verlage. Die Situation acht Jahre später, also 1908, wurde folgendermaßen beurteilt: „Die Folgen des Gesetzes vom Jahre 1895 waren aber allgemein für den österreichischen Verlag so verderblich, daß alle interessierten Kreise sich nicht begnügten, auf den Stand der Dinge in Amerika hinzuweisen, sondern immer wieder in Petitionen und Eingaben zu diesem Gesetz Stellung nahmen und den Abschluß von Staatsverträgen außer mit Nordamerika noch mit der Schweiz, Rumänien und dem skandinavischen Norden verlangten.“[15] Bis 1911 hatte sich die Situation auch nicht wesentlich geändert. So wiesen der Verein der österreichisch-ungarischen Buchhändler und die Korporation der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhändler in einer Eingabe an das Justizministerium auf die drohende Gefahr hin, „daß mehrere hervorragende österreichische Buch- und insbesondere wegen der stets wachsenden Bedeutung der Wiener Operette auch Musikalienhändler ihre Verlagstätigkeit nach Deutschland verlegen müßten, um ihren Werken und deren Autoren den vollen Schutz der Berner Union zu sichern. Ein derartiger Exodus würde aber von sehr schlechten Folgen für die österreichische Buch-, Druck- und Verlagsindustrie begleitet sein.“[16]
Hätten die Regierungen Österreichs und Ungarns sich nicht geweigert, der Berner Convention beizutreten und sich nicht für die nächsten dreiundzwanzig Jahre von der internationalen Entwicklung absentiert, so hätte sich, wie man mit Sicherheit annehmen kann, das Verlagswesen in Österreich vor allem auf dem Gebiet der schönen Literatur sehr zum Positiven geändert. Eben bis auf die Regierung (die innenpolitisch nicht anders konnte) waren alle betroffenen Kreise in Österreich-Ungarn, – oder um genau zu sein: in den deutschen Ländern der Monarchie – für einen Beitritt.
Schon im Jahre 1890 wurde in der Hauptversammlung des Vereins der österreichisch-ungarischen Buchhändler der Wunsch nach Angleichung der nationalen Gesetzgebung an die internationale Regelung der Konvention ausgesprochen. Im Jahre 1892 wurde die Bitte an die Regierung herangetragen, einen Schutzvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika, der in Gestalt der am 3. März 1891 in Kraft getretenen „Manufacturing Clause“ für europäische Begriffe eher ungewöhnliche Bestimmungen zur Wahrung des Urheberrechts beinhaltete,[17] einzugehen. Hier hatte nämlich das Problem mit Nachdrucken immer größere Dimensionen angenommen. Da aber der Börsenverein des deutschen Buchhandels in Leipzig mit den USA eine Abmachung getroffen hatte, nahm man in Österreich irrigerweise an, daß die Wirkungen des Abkommens des Börsenvereins sich auch auf die österreichischen Mitglieder bezögen, was aber nicht stimmte.[18]
In der Hauptversammlung des Vereins am 22. Oktober 1899 wurde der Beitritt „mit Rücksicht auf den unzulänglichen Schutz österreichischer Verlagsartikel im Auslande“ neuerlich gefordert (Junker, Berner Convention, S. 105). Wieder forderte man den Abschluß eines Staatsvertrags zum gegenseitigen Schutz der Werke der Literatur und Kunst mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Junker schloß seine Analyse 1900 mit folgendem frommen Wunsch: „Möge diese Action [diverser Standesvertretungen] endlich den längst ersehnten Erfolg haben“ (ebda., S. 107). Der „Erfolg“ stellte sich allerdings erst zwei Jahrzehnte später und unter ganz anderen Umständen ein. Zwei Jahre später wurde der Beitritt in einer Sitzung des Abgeordnetenhauses befürwortet. Erneut wurde von einem Abgeordneten der altbekannte befürwortete Standpunkt vorgetragen. Er meinte, das „österreichische Urheberrechtsgesetz vom Jahre 1895 enthalte in Bezug auf die internationalen Verhältnisse ganz ungenügende Bestimmungen und basiere auf einem ganz anachronistischen Standpunkte.
Unsere literarische Produktion mit dem Handel mit Werken der Kunst und Literatur erfahre dadurch eine große Schädigung. Die Folge dieses Umstandes sei auch, daß viele einheimische Autoren ihre Werke im Auslande veröffentlichen, wo sie besseren Schutz genießen.“[19]
Der österreichische Beitritt zur Convention fand z.B. einen lebhaften Befürworter in der Person Peter Roseggers, der 1895 an einen Briefpartner folgendes schrieb:
Und ob ich der Berner Convention beistimme! Viele meiner Bücher sind im Holländischen, Dänischen, Schwedischen und Englischen erschienen und in Amerika werden sie deutsch herausgegeben, ohne daß ich einen Kreuzer Honorar je bekommen hätte. (zit. nach Junker, Berner Convention, S. 73)
Rosegger war in der österreichischen Literatur sicherlich keine Einzelerscheinung. In der englischen Literatur ist Charles Dickens ein geradezu klassisches Beispiel dafür, wie „Erfolg“ und „Verbreitung“ einem ungeschützten Autor wenig nützten. Trotz der ungeheuren Popularität und des massenhaften Verkaufs seiner Werke in den Vereinigten Staaten zum Beispiel bekam Dickens keinen Kreuzer dafür.[20]
e) Gründe für den Nicht-Beitritt
Der Anschluß an die Berner Convention hätte vor allem der Donaumonarchie das Eingehen von zehn und mehr Staatsverträgen, also die Regelung von zwischenstaatlichen Urheberrechtsbeziehungen durch einzelne, zweiseitige Verträge, erspart. Nach Ansicht eines Zeitgenossen war der Beitritt „ein Postulat der Zivilisation und des völkerrechtlichen Anstandes. Fremde Geistesprodukte sich ohne weiteres anzueignen, das ist der Standpunkt des Standrechtes, ist ein mittelalterlicher Gedankenrest.“[21] Österreich-Ungarn blieb beim Mittelalter. Dabei hätte der Beitritt dazu beigetragen, die österreichische Literatur einigermaßen zu repatriieren oder zumindest einen Anreiz zu geben, im heimischen Verlag zu veröffentlichen, ohne daß sich andere unverdienterweise bereichern konnten, und schließlich den belletristischen Verlagen in Österreich, zumindest vom ideellen Gesichtspunkt aus gesehen, eine vielversprechende Ausgangsbasis zu geben. Wie die Dinge lagen, entstand für Österreich nicht nur eine immaterielle, sondern auch, wie erwähnt, eine volkswirtschaftliche Schädigung. Es muß aber hervorgehoben werden, daß der deutsche Österreicher sich von alters her als Deutscher fühlte, und daher stimmte ihn das Empfinden, daß die „österreichische Literatur“ außer Landes beheimatet sei, keineswegs bedenklich.
Es gab zwei Gründe für die offizielle Ablehnung eines Beitritts. Am Anfang stand nicht ein rein literarisches oder gar juristisches Problem, sondern vielmehr der wachsende Nationalismus unter den Ländern des Vielvölkerstaats. Im kulturellen Nachholprozeß unter Zurückdrängung der deutschen Sprache und der deutschen Absatzgebiete sowie unter Förderung der Nationalsprache und der nationalen Kultur war man, wie z.B. eine im Jahre 1900 vom Justizministerium veranstaltete Umfrage ergab, an einer Ausdehnung des bestehenden Urheberrechtsschutzes nicht interessiert. So standen namentlich die slawischen Gebiete Österreichs dem Gedanken ablehnend gegenüber.[22] Man war der Ansicht, daß eine Ausdehnung den besonderen Verhältnissen Österreichs, eben als Vielvölkerstaat, nicht entspreche. Der Konventionsschutz gegen unbefugte Übersetzungen fremdsprachiger Werke schien den sprachlichen Minderheiten als unerträgliche Beeinträchtigung ihrer kulturellen Entwicklung. Anders formuliert: Österreich unterließ diesen Beitritt „hauptsächlich zu dem Zwecke, damit die slawischen Völkerschaften Österreichs wie früher auch fürderhin recht bald in die Lage kommen, sich gleichwie die inländischen so auch die ausländischen geschützten literarischen Werke ohne weiteres in ihre Sprachen zu übersetzen. (…) Da die Urheber in jenen Staaten, mit denen wir in Literarkonvention stehen, also die Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens – von Ungarn wird hier ganz abgesehen – in Österreich nur denjenigen Urheberrechtschutz genießen, den das österreichische Urheberrechtsgesetz gewährt, so stand es den slawischen Volksstämmen, freilich auch dem italienischen Volksstamme Österreichs bis zum Ende des Jahres 1895 frei, von allen neuesten deutschösterreichischen, reichsdeutschen, französischen, englischen und italienischen Romanen, Novellen, Dramen usw. schon nach einem Jahre, und steht ihnen seit dem Ende des Jahres 1895 frei, von allen diesen Werken schon spätestens nach acht Jahren Übersetzungen in ihren slawischen Sprachen herauszugeben, was sie beim Anschlusse Österreichs an die Berner Konvention nicht mehr vermochten.“[23]
Inzwischen (1906) waren nämlich fünf weitere Staaten (Norwegen, Dänemark, Schweden, Monaco, Japan) der Convention beigetreten. Es bestand wenig Aussicht auf einen Beitritt Österreichs, vor allem aus dem Grund, weil ein solcher Schritt der Zustimmung beider Häuser des Reichsrats bedurfte und die nichtdeutschen Völker den entscheidenden Einfluß im Parlament besaßen. Um die Jahrhundertwende standen dem Beitritt Österreichs auch sonst „staatsrechtliche Bedenken“ entgegen: „Ohne ein unliebsames Präjudiz zu schaffen, wäre es damals für Österreich allein ohne Zustimmung Ungarns schwer gewesen, der Berner Union beizutreten.“[24] Aber seit den neuen Ausgleichsgesetzen war der Abschluß von Staatsverträgen anders geregelt worden. In einer Eingabe des Vereins und der Korporation an das Justizministerium im Jahre 1911 vertritt man die Ansicht, daß die „staatsrechtlichen Bedenken“ nicht mehr bestanden und daß daher der Weg für einen Beitritt Österreich frei sei.[25]
Zwei Jahre später schien in dieser Angelegenheit tatsächlich ein Fortschritt erzielt worden zu sein. Die ungarische Regierung gab eine offizielle Erklärung dahingehend ab, daß deren Justizministerium nun einen Gesetzesentwurf betreffend den Beitritt Ungarns zur Berner Convention bereits ausgearbeitet habe und daß dieser Gesetzentwurf demnächst (Frühsommer 1913) dem Parlament zugehen werde. Ungefähr gleichzeitig wurde auch bekannt, daß ebenso die österreichische Regierung sich mit dieser Frage „eifrig beschäftigte“ und daß sie willens sei, so bald wie möglich dem Parlament einen ebensolchen Gesetzesentwurf zu unterbreiten.[26] Was in den Ohren der Betroffenen und Interessierten wie langersehnte schöne Musik klang, wurde alsbald zur Enttäuschung. Denn beide Regierungen vertraten den Standpunkt, daß erst das inländische Urheberrecht, das weit zurückgeblieben war, im Sinne der Berner Convention geändert werden müsse, bevor Österreich bzw. Ungarn der Convention beitreten könne. Eine Lösung war wiederum in die weite Ferne gerückt worden.
Ein zweites Motiv in der Ablehnung waren die z.T. recht erheblichen Differenzen zwischen den Bestimmungen der Convention und denjenigen des österreichischen Urheberrechts. Man wollte zunächst mit dem heimischen „Anachronismus“ ins reine kommen und die Verhältnisse mit den nichtdeutschen Nationen der Monarchie klären. Aber das ganze Problem wurde immer wieder auf die lange Bank geschoben.
f) Weiterentwicklung in Österreich bis 1920
Seit dem Staatsvertrag mit dem Deutschen Reich vom 30. Dezember 1889 vergingen mehrere Jahre, bis ein weiterer Vertrag abgeschlossen worden war. Dieser war durch eine kurze Urheberrechtsnovelle vom 26. Februar 1907 (RGBl. Nr. 58) erst ermöglicht worden. Hauptzweck dieser Änderung war die Wiederaufnahme der Reziprozitätsklausel, die im Autorrechtspatent vom 19. Oktober 1846 enthalten war und im Gesetz vom Jahre 1895 fallengelassen wurde. Die Novelle bestand eigentlich nur aus folgendem Zusatz:
Insoweit Staatsverträge nicht bestehen, können auf solche Werke unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit die Bestimmungen dieses Gesetzes ganz oder teilweise durch eine im Reichsgesetzblatt kundzumachende Verordnung des Justizministers anwendbar erklärt werden. (RGBl., Jg. 1907, XXIX. Stück, Nr. 58, S. 352)
Diese Novelle wurde erwartungsgemäß von den österreichischen Buch-, Kunst- und Musikalienhändlern „Mit großem Beifall begrüßt“[27], „auf das lebhafteste begrüßt“[28] und galt als „ein wertvoller Erfolg“ (ebda.).
Auf Grund dieser Novelle und der „Verordnung des Justizministers vom 18. Juli 1907 über den Urheberrechtsschutz im Verhältnisse zu Dänemark“[29] bestand ab 1. August 1907 zwischen Österreich und Dänemark ein gegenseitiger Urheberrechtsschutz.
Von allergrößter Bedeutung war jedoch die Herstellung eines Reziprozitätsverhältnisses mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Es erfolgte durch eine Verordnung des Justizministers vom 9. Dezember 1907[30] und trat am selben Tag in Kraft. Nach Sektion 13 der Kongreßakte vom 3. März 1891 fanden nämlich die Bestimmungen der Urheberrechtsgesetzgebung der USA auf Ausländer Anwendung, wenn der fremde Staat den Bürgern der USA einen im wesentlichen gleichen Schutz gewährte. Durch die österreichische Novelle vom Februar 1907 stand dem Abkommen nun nichts mehr im Wege.
Mit einer ähnlichen Verordnung vom 17. Mai 1908[31] bestand ab 1. Juni 1908 zwischen Schweden und Österreich ein ähnlicher Schutz. Im selben Jahr erfolgte ein solches Abkommen mit Rumänien.[32]
Weitere Abkommen wurden angestrebt, sind jedoch z.T. auch kriegsbedingt nicht zustandegekommen. Das letzte, einseitige Urheberrechtsabkommen wurde zu einem sehr späten Zeitpunkt abgeschlossen. Mit der Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom 8. April 1919 wurde der Schutz des Urheberrechts an Werken der Literatur, Kunst und Photographie im Verhältnis zum tschechoslowakischen Staat geregelt.[33] Auch diesem Abkommen lag das Reziprozitätsprinzip zugrunde.
Erst 33 Jahre nach Beschluß der Berner Convention erfolgte der Beitritt der nunmehrigen Republik Österreich zu dieser Übereinkunft – und das nicht aus freien Stücken.
Zunächst wurde das Urheberrechtsgesetz vom Dezember 1895 im Juli 1920 novelliert. Das neue Gesetz, das am 1. August in Kraft trat, bezweckte in erster Linie den Anschluß der Republik Österreich an die Berner Convention, der in Kürze folgen sollte. Nicht der freie Entschluß hatte zu diesem Schritt geführt, sondern der Artikel 239 des Vertrags von St. Germain verpflichtete die Republik Österreich, dem revidierten Übereinkommen beizutreten. Die Änderung des österreichischen Urheberrechts hatte in einer sehr kurzen Zeit zu erfolgen, und das bedeutete nicht eine durchgreifende Reform, sondern in erster Linie eine Anpassung. Spät aber doch war eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung des belletristischen Verlags in Österreich gegeben. Man war allgemein der Ansicht, daß der Beitritt einen großen Fortschritt hinsichtlich des Schutzes der literarischen Werke bedeutete.[34]
Es vergingen eineinhalb Jahrzehnte, bis eine eingehende Umgestaltung des österreichischen Urheberrechts, die sowohl den seit 1908 (Revidiertes Berner Übereinkommen) erzielten technischen Neuerungen entsprach als auch dem neuen Rechtsgedanken Rechnung trug, Wirklichkeit wurde. Das geschah nach langen Vorbereitungen am 9. April 1936 mit dem „Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)“[35]
g) Der Verlag und das Preßgesetz
Österreich kann sich traditionell nicht zu den Ländern zählen (z.B. angelsächsische Länder), die sich einer liberalen Preßgesetzgebung erfreuen konnten. Verbot, Zensur, Vorzensur, Beschlagnahme sind die markantesten Merkmale ihrer Geschichte.
Wir haben die Frage der Zensur kurz angerissen und wollen jetzt einige Auswirkungen der Preßgesetzgebung auf den österreichischen Verlag bis zum Ende der Monarchie nachtragen. Der Verlag hatte der Natur nach eine Affinität zum Buchhandel (Gewerbe-Ordnung) sowie zum Druckwesen im allgemeinen (Preßgesetze).
Carl Junker kritisierte 1900, Österreichs Gesetzgeber hätten „wiederholt versäumt den Fortschritten der Cultur zu folgen“ (Verein, S. 34). Das Resultat seien „Gesetze, die mit den jeweiligen Bedürfnissen des Lebens nicht mehr in Einklang stehen“ (ebda.). Auf keinem Gebiet, meinte er, ließe sich diese Behauptung leichter erweisen, als auf jenem des Preßgesetzes. Eben dieses Gesetz sei, so Junker, „denn auch für den österreichischen Buchhandel geradezu verhängnisvoll und verderblich geworden“ (ebda., S. 34). Das lag z.B. daran, daß der Verleger durch die Abgabe einer verhältnismäßig großen Anzahl von Pflichtexemplaren schwer belastet war.[36] Junker schreibt zu diese in Thema:
Das Drückende der Ablieferung einer verhältnißmäßig so großen Anzahl von Pflichtexemplaren ist zwar schon in früheren Jahren hart empfunden worden und hat schon 1875 zu einer Petition an das Abgeordnetenhaus geführt, in welcher ziffermäßig nachgewiesen wurde, daß diese Steuer etwa 6½ Procent des Reingewinnes betrage, nahm aber seither noch um vieles zu, da die moderne Buchausstattung eine luxuriösere und kostspieligere geworden ist, und die Werke mit Tafeln in Kunstdruck häufiger als früher vorkommen. Auch lassen neuere behördliche Gesetzesauslegungen und gerichtliche Entscheidungen, denen zufolge auch von Separatabdrücken, ja sogar von den einzelnen Orchesterstimmen, die doch nur Auszüge aus der Partitur sind, Pflichtexemplare abgeliefert werden müssen, was kaum dem Geiste des Gesetzes entspricht, die Bestimmung des § 18 des P.-G. für den Verleger gegenüber der älteren Praxis noch weit ungünstiger erscheinen. Der Vorstand des Vereines hat infolge dessen in jüngster Zeit abermals das Justizministerium um Erleichterungen in dieser Richtung gebeten, doch ist eine Erledigung dieser Eingabe noch nicht erfolgt. (Verein, S. 35)
Das Warten auf eine den Zeitverhältnissen angepaßte Reform – wie etwa die Freigabe der Kolportage – war, wie im Fall „Beitritt zur Berner Convention“ wie ein „Warten auf Godot“. Erst mit dem neuen, republikanischen Preßgesetz vom April 1922 wurde die Praxis z.B. mit Pflichtexemplaren neu geregelt.
In seinem Überblick über den „deutsch-österreichischen Verlagsbuchhandel“ im Börsenblatt 1919 meinte Eckardt, es hätte nicht an Versuchen gefehlt, einen großen österreichischen Verlag zu schaffen und die österreichischen Autoren durch ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Zu einem Großteil fehlte diesen Versuchen aber jene geschäftliche Rührigkeit, die den reichsdeutschen Verlagsbuchhandel auszeichnet.“ Ähnlich schrieb Karl Wache 1923 von der „Trägheit der Verlegertätigkeit in den letzten 30 Jahren“[37] vor dem Umbruch.
Eckardt meinte zudem, der Hauptgrund für die fehlende Entwicklung eines belletristischen Verlags wäre historischer Natur. Er verweist darauf, daß es in Deutschland schon im 18. Jahrhundert bedeutende Verlagsgründungen, wie Cotta in Stuttgart, Nicolai in Berlin u.a. gegeben hätte. in Österreich blieb es bei Ansätzen. Nach Ansicht Eckardts hätten die kleinen Fürsten Deutschlands an den kulturellen Fragen oft ein ganz erstaunliches Interesse. In Österreich hingegen, waren es vor allem die deutschen Österreicher, die „in dieser Zeit in erster Linie und fast ausschließlich politische, historische Aufgaben zu erfüllen“ (a.a.O., S. 235) hatten.
Anmerkungen
[1] CARL JUNKER, Die geschichtliche Entwicklung des Buchhandels in Österreich. Den Teilnehmern an der Buchhändlertagung Wien 1926. Wien: Amalthea Verlag, 1926. Auch in: Börsenblatt, 93. Jg., Nr. 206, 4.9.1926, S. 1086-1088 und WZ, Nr. 216, 18.9.1926, S. 1, 2, 3. Zu diesem Thema siehe auch den Abdruck eines Vortrags von EUGEN MARX, Über Entwickelung und Organisation des Buchhandels in Deutschland und Österreich. In: Österreichische Buchdrucker-Zeitung, 7. Jg., Nr. 21, 22.5.1879, S. 167-168; Nr. 23, 5.6.1879, S. 187-188; Nr. 27, 3.7.1879, S. 218-220; Nr. 28, 10.7.1879, S. 227-229; Der Vollständigkeit halber wird auf ein weiteres, 1928 erschienenes Buch: Der österreichische Buchhandel in der Nachkriegszeit von einem Dr. ADOLF STIERLE hingewiesen. In diesem 80 Seiten starken Werk, das zudem einen durchgesehenen und ergänzten Abdruck einer Dissertation zur Erlangung des Doktorates der Staatswissenschaften repräsentiert, ist bis auf die Statistiken und Tabellen zu 90% – ohne entsprechende Quellenangabe – von Publikationen Carl Junkers wortwörtlich und großflächig von der ersten bis zur letzten Seite abgeschrieben worden. Stierles gedruckte Dissertation enthält kaum einen originellen Gedanken übernimmt ohne Angabe alles bis auf die gesperrten Textteile von Junker und scheut jede Mühe, die Spuren zu verwischen. Es scheint mir daher überflüssig, in diesem Zusammenhang aus dem Werk Stierles zu zitieren. Stierle ist am 28.1.1906 in Salzburg geboren und am 30.6.1970 ebda. gestorben.
[2] Sonderpostmarke. 500 Jahre Druck in Österreich (1482-1982). Legende verfaßt von Anton Durstmüller d.J. und Hans Inmann. Dazu auch ANTON DURSTMÜLLER d.J., 500 Jahre Druck in Österreich. Die Entwicklungsgeschichte der graphischen Gewerbe von den Anfängen bis zur Gegenwart. (Band 1) Wien: Hauptverband der graphischen Unternehmungen Österreichs, 1982.
[3] Diese Ordnung ist abgedruckt in: Korporation der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhändler. 1807-1907. Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Korporation am 2. Juni 1907. Von CARL JUNKER, S. 45-47; bes. 46.
[4] CARL JUNKER, Der Verlagsbuchhandel in der Republik Österreich. Betrachtungen anläßlich der ersten Wiener Buchmesse. (Sonderdruck aus Deutsche Verlegerzeitung, 1921, Nr. 22), S. 2; von Stierle, S. 19 wortwörtlich übernommen, HEINRICH SARTOR, Das Wiener Buch auf der Wiener Messe, in: Die Initiale (Wien), Erstes Jahr, Viertes Heft, September 1921, S. 2-6; bes. S. 2: „… weil sie in Wien keinen Verlag von hinreichender Bedeutung fanden.“ JOHANNES ECKARDT, Der deutsch-österreichische Verlagsbuchhandel. In: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, Nr. 67, 7. April 1919, S. 234-236; bes. S. 234: „So konnte sich kein wirklich bedeutender österreichischer Verlag entwickeln.“
[5] ECKARDT, zit. Anm. 4, S. 234.
[6] Siehe die Anzeige des S. Fischer Verlags in der Österr.-ungar. Buchhändler-Correspondenz (in Zukunft: BC), Nr. 36, 13. November 1918, S. 542: „Auf Wunsch und im Interesse unserer österreichischen Autoren, deren wir gegenwärtig etwa 35 zählen, haben wir jetzt die seit Anfang dieses Jahres geplante österreichische Filiale S. Fischer, Verlag, Wien VIII., Florianigasse 23 eröffnet. (…)“ Die Gründung einer österreichischen Filiale hatte auch andere Motive. In Deutschland wie in Österreich nach Ende des Ersten Weltkriegs war – wie wir sehen werden – das Problem Nummer Eins die Papierbeschaffung. Fischer hoffte indirekt somit zu einer Papierquelle zu kommen, indem er sich bei der Regierung einen guten österreichischen „Leumund“ verschaffte. Auch Reclam und Staackmann warben ausdrücklich für die Bücher österreichischer Autoren. Der Insel-Verlag zu Leipzig stellte außerdem die von HUGO HOFMANNSTHAL herausgegebene „Österreichische Bibliothek“ her. In direkter Anspielung auf S. Fischer schrieb Heinrich Sartor (zit. Anm. 4): „Der Wiener Literaturepoche von 1890 gehörten eine ganze Reihe prominenter Geister an, wie Altenberg, Bahr, Hofmannsthal, Schnitzler, Wassermann und andere, die alle im Hafen des deutschen Verlagsbuchhandels landeten, weil sie in Wien keinen Verlag von hinreichender Bedeutung fanden.“
[7] ECKARDT, zit. Anm. 4, S. 235 f.
[8] Die Analyse Junkers erschien 1900 in Wien bei Alfred Hölder. Zitat S. 43.
[9] In diesem Abschnitt herangezogene Literatur: CARL JUNKER, Die Berner Convention zum Schutze der Werke der Litteratur und Kunst und Österreich-Ungarn. Wien: Hölder 1900; Dr. ALFRED SEILLER, Österreichisches Urheberrecht. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1927. (= Juristische Taschenbücher für die Praxis und zum Studium an technischen und verwandten Hochschulen. Hrsg. Dr. Hans Frisch. Band 6); HARALD KUTSCHERA, Die Berner Konvention und das österreichische Urheberrecht. phil. Diss. Wien 1949; HARALD SCHNATTINGER, Studien zum Wiener Verlagswesen des 19. Jahrhunderts. phil. Diss. Wien 1951; GÜNTHER WESSIG, Das österreichische Urheberrecht, seine Entwicklung, Handhabung und seine Bedeutung für das Zeitungswesen. phil. Diss. Wien 1956.
[9] Der Verein der österreichisch-ungarischen Buchhändler 1859-1899. Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Buchhandels. Festschrift anläßlich des vierzigjährigen Bestandes des Vereines im Auftrage des Vorstandes verfaßt von CARL JUNKER. Wien 1899, S. 32. (Im folgenden als „Verein“ mit Seitenzahl abgekürzt.)
[11] Siehe H. SCHNATTINGER, zit. Anm. 9, S. 97. Die Vorschläge wurden vom Hof- und Gerichts-Advokaten Dr. C. Grünwald ausgearbeitet.
[12] Die hier folgende Darstellung stützt sich im wesentlichen auf die detaillierten Ausführungen von ALFRED SEILLER, zit. Anm. 9.
[13] Im Herbst 1912 war eine Aufführung von ARTHUR SCHNITZLERS Reigen in Ungarn in ungarischer Sprache in Vorbereitung. Der Autor meinte in einem Brief vom 13.9.1912: „Da dort das Stück ungeschützt ist, so werde ich wohl, um mich nicht aller Rechte a priori zu begeben, durch meinen Vertreter mit den betreffenden Leuten in Verhandlung treten müssen.“ (ARTHUR SCHNITZLER Briefe. 1875-1912. Herausgegeben von Therese Nikl und Heinrich Schnitzler. Frankfurt/Main: Fischer, 1981, S. 699. Siehe auch die Tagebucheintragungen Schnitzlers in: ARTHUR SCHNITZLER, Tagebuch. 1909-1912. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981. 1912: IX 24, S. 355; 1912: X 16, S. 361.
[14] Ansicht der Korporation, in: BC, Nr. 34, 19. August 1908, S. 470.
[15] Ebenda.
[16] Österreich und die Berner Konvention zum Schutze der Werke der Literatur und Kunst“ In: BC, Nr. 14, 5. April 1911, S. 175 f.; bes. S. 176.>
[17] Siehe SEILLER, zit. Anm. 9, S. 261-263. Zur Wahrung der Urheberrechte in den USA war es nach Art. 3 notwendig, spätestens am Tage der Veröffentlichung des Werkes im In- oder Ausland beim Bureau des Kongreßbibliothekars in Washington ein gedrucktes Exemplar des Titels des Werkes und ferner zwei Exemplare des Werkes zu erlegen. Für den außerhalb der USA wohnenden Urheber war diese Bestimmung eine große Erschwerung.
[18] SCHNATTINGER, zit. Anm. 9, S. 97.
[19] BC, Nr. 22, 28. Mai 1902, S. 347.
[20] Das Raubrittertum betraf keineswegs nur österreichische Autoren im Ausland. Ein Beispiel dafür, wie man von Österreich aus, mit Autoren – vor allem aus Rußland und Skandinavien und Amerika – unter Ausnützung sämtlicher urheberrechtlicher Drehs ein glänzendes Geschäft machen konnte, liefert z.B. der „Wiener Verlag“ unter der Leitung des jungen Inhabers Fritz Freund. Der Verf. plant eine eingehende Arbeit über diesen Verlag unter Heranziehung solcher Fälle. Siehe auch den Abschnitt über den „Wiener Verlag“ an späterer Stelle.
[21] Dr. GOTTLIEB FERDINAND ALTSCHUL: Österreich und die Berner Konvention. (Abdruck aus dem Neuen Wiener Tagblatt, in: BC, Nr. 46, 14. November 1906, S. 56f.; hier S. 657.)
[22] SEILLER, zit. Anm. 9, S. 5 f.
[23] ALTSCHUL, zit. Anm. 21, S. 657.
[24] Österreich und die Berner Konvention zum Schutze der Werke der Literatur und Kunst“. In: BC, Nr. 14, 5. April 1911, S. 175 f.; bes. S. 176.
[25] Ebenda, S. 176.
[26] Mitteilung WILHELM MÜLLERS im Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung des Vereins vom 21. Juni 1913. In: BC, Nr. 26, 25. Juni 1913, S. 344 f.; bes. S. 345.
[27] BC, Nr. 34, 19. August 1908, S. 470.
[28] BC, Nr. 14, 5. April 1911, S. 175.
[29} RGBl., Jg. 1907, LXXVI. Stück, Nr. 168, S. 699.
[30] RGBl., Jg. 1907, CXXI. Stück, Nr. 265, S. 1084.
[31] RGBl., Jg. 1908, XLVII. Stück, Nr. 101, S. 359 f. Siehe auch BC, Nr. 23, 3. Juni 1908, S. 323 f.<
[32] Siehe BC, Nr. 25, 17. Juni 1908, S. 349 f.
[33] Siehe BC, Nr. 17, 23. April 1919, S. 240.
[34] „La loi du 13 juillet 1920, qui modifie celle du 26 décembre 1895 sur de nombreaux points, réalise sans aucun doute un grand progrès dans le développement de la protection littéraire autrichienne.“ Dr. Em. Adler: „Lettre d’Autriche.“ In: Droit d“Auteur, no. 6, 15.6.1921, S. 67-71; hier S. 68. Österreich war keineswegs der letzte Staat, der der Berner Convention beitrat. Um einige Beispiele zu nennen: Bulgarien war seit 5.12.1921, Griechenland seit 9.11.1920, Polen seit 28.1.1920, Rumänien seit 1.1.1927, die Tschechoslowakei seit 22.2.1921 und Ungarn seit 14.2.1922 Unionsmitglied. (Siehe: Anzeiger, 70. Jg., Nr. 11, 15.3.1929, S. 76 f. „Die Berner Übereinkunft nach dem Stande vom 1. Jänner 1929.“)
[35] Zur Entwicklung dieses Gesetzes siehe KUTSCHERA und WESSIG, beide zit. Anm. 9.
[36] Die sogenannte Hinterlegungspflicht war durch § 17 des Preßgesetzes vom 17. Dezember 1862, RGBl. Nr. 6/1863 geregelt. Von jedem einzelnen Blatt oder Heft einer periodischen Druckschrift hatte der Drucker wenigstens eine Stunde, von jeder anderen Druckschrift aber wenigstens acht Tage vor dem Zeitpunkt der Ausgabe bei der Sicherheitsbehörde des Abgabeortes, und an Orten, wo ein Staatsanwalt seinen Sitz hatte, auch bei diesem ein Exemplar zu hinterlegen. So sah die Handhabung dieses Gesetzes am 26. Juli 1914, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, anläßlich der Suspension der Preßfreiheit aus. Die Pflichtexemplare mußten u.a. an das Cultus- und das Innenministerium geliefert werden. Siehe dazu u.a. „Pflichtexemplare“, in: BC, Nr. 26-28, 14. Juli 1920, S. 295 f.
[37] KARL WACHE, Österreichs Dichtung seit dem Umsturze. In: Neu-Österreich. Das Werk des Friedens von St. Germain. Zusammengestellt von Dr. EDUARD STUPAN. Amsterdam/Wien, 1923, S. 157-163; bes. S. 157.
3. Allgemeine Entwicklung des Verlags bis 1918
Wie andere Wirtschaftszweige auch war der Verlagsbuchhandel von sozialen, politischen und konjunkturellen Entwicklungen unmittelbar beeinflußt. Der Gradmesser seines Gedeihens reicht von politischen und kulturellen Autonomiebestrebungen zu den Valutaschwankungen, von der Papierbeschaffung bis zur Kaufkraft und Kauflust des Publikums, Druckerei und Verlag, Sortimenter und Publikum bilden ein kompaktes Gefüge.
Um an den Ausgangspunkt bzw. status quo der Entwicklung im Verlagsbuchhandel in Österreich ab 1918 zu gelangen, versuchen wir in groben Zügen, die Entwicklungen ab etwa 1860 mit besonderer Berücksichtigung des Jahrzehnts vor dem Ende des Ersten Weltkriegs zu umreißen.[38]
Der „deutsche“ Buchhandel im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn hatte die größte Verbreitung und nahm in jeder Beziehung die erste Stelle ein. Neben seiner selbständigen Stellung im Kaiserstaat bzw. in der Doppelmonarchie war der österreichische deutsche Buchhandel zugleich ein Teil des gesamtdeutschen Buchhandels. Im Jahre 1825 – die Österreicher zogen erst ein Vierteljahrhundert später nach – war es zur Schaffung einer festen Organisation, des Börsenvereins der deutschen Buchhändler, gekommen. Seine Aufgabe: die Interessen aller „deutschen Buchhändler“, also auch die außerhalb Deutschlands, zu vertreten.[39] Ein Grundpfeiler dieser Organisation war der einheitliche, überall geltende Ladenpreis, eine Regelung, die große Vorteile, zuweilen – etwa in Zeiten rasanter Teuerung oder Valutaschwankungen – auch ungeheure Nachteile haben konnte.
Der Impuls, den gesamten österreichischen Buchhandel eigens zu organisieren, ging vom deutschösterreichischen Buchhandel aus. Bestrebungen in diese Richtung waren bereits vor 1848 im Gange. Aber erst im Jahre 1859 kam es zur Gründung des „Vereins der österreichischen Buchhändler“.
Hatte etwa Wien Anfang des 19. Jahrhunderts kaum 30 Buchhandlungen, betrug die Zahl in ganz Österreich 1859 bereits 362, und das in 114 Orten. In dem folgenden halben Jahrhundert kam es zu einer sprunghaften Entwicklung. Bis zum Jahre 1909 hatte sich die Zahl fast verfünffacht: An 506 Orten befanden sich nun an die 2.000 Buchhandlungen. Das Adreßbuch 1918 enthielt gar 3.137 österreichisch-ungarische Firmen, die sich an 899 Orten befanden.[40]
Nach den Statuten des Vereins von 1859 umfaßte der Buchhandel vier verschiedene Geschäftszweige: den eigentlichen Buchhandel, den Kunst- und Musikalien- und Landkartenhandel. jede dieser Sparten zerfiel in Verlags- (d.h. Herstellungs-) und Sortiments- (d.h. Verkaufs-) geschäfte. Auf Grund der hier geprägten und den Zustand widerspiegelnden Strukturen gab es in den nächsten vierzig Jahren bis auf wenige Ausnahmen bloß den Buchhändler-Verleger (den ‚Auch-Verleger’) und noch nicht jene Species des „Nur-Verlegers“. Mit anderen Worten: Die „Verlagsbuchhändler“ konnten sowohl das eine als auch das andere sein. In dieser Struktur war der reine Verlag eindeutig unterrepräsentiert, und dieses Faktum kennzeichnet die österreichische Situation bis 1938 und danach.
Während des Zeitraums von 1859 bis zum Anfang des Ersten Weltkriegs hatte sich das Verhältnis Buchhandlung- Bevölkerung auch unter Berücksichtigung einer größeren Leser- und Kaufschicht erheblich verkleinert. Umgekehrt ist ein sprunghafter Anstieg in Verkehr und Absatz reichsdeutscher und sonstiger ausländischer Bücher zu registrieren. Importierte Österreich zwischen 1851 und 1861 im Durchschnitt 9.300 Meterzentner Bücher jährlich, so stieg diese Zahl mit einigem durch Krieg (1866) und Finanzkrise (1873) bedingten Auf und Ab bis 1881 auf 27.000 Meterzentner an. Auf Grund einer gleichmäßigen Steigerung machte der Bücherimport 1890 bereits 39.000 Meterzentner aus. Dieses Tempo hielt in dem Ausmaß an, daß das Jahr 1895 mit 55.000, das Jahr 1900 mit 73.000 und schließlich das Jahr 1905 mit 85.000 Meterzentner Bruttoeinfuhr ausgewiesen war. So hatte sich der Bücherimport nach Österreich innerhalb von fünf Jahrzehnten nahezu verzehnfacht. Hier sind bereits die Grundlagen für die verhängnisvollen Marktbedingungen, die „Abhängigkeiten“, das einseitige Ausgerichtetsein des gesamten republikanischen Buchhandels in Österreich in späteren Jahren ersichtlich. Denn der Anteil des Deutschen Reichs an der oben erwähnten Gesamteinfuhr betrug im Durchschnitt schon damals nicht weniger als 90%. Und an dieser Gegebenheit änderte sich bis zum „Anschluß“ Österreichs praktisch nichts. Zum Unterschied aber von der Situation in Österreich etwa 1935, als patriotische Österreicher einen „österreichischen Verlag“ anregten und forderten, registrierte man – ohne Klage, ohne Bedauern, ohne Aufruf zur Änderung – – bloß den allzu deutlichen Überhang reichsdeutscher Werke auf dem österreichischen Markt.
Es ist wohl anzunehmen, daß der Löwenanteil der in diesem Prozentsatz enthaltenen und wirklich abgesetzten Bücher in jenen Teilen der Monarchie verbreitet wurde, wo „deutsche Österreicher“ wohnten. Daß man sich ob der Dominanz reichsdeutscher Verlagswerke nicht beschwerte, mag dahingehend zu erklären sein, daß der Nationalismus im Vielvölkerstaat nicht auf die Slawen, Magyaren usw. beschränkt war, sondern auch den deutschen Bevölkerungsteil der Monarchie betraf, der sich nicht den übrigen Völkerstämmen der Monarchie wesensverwandt fühlte, sondern den Deutschen im Deutschen Reich.
Aus zeitgenössischen Analysen der Entwicklung des österreichischen Buchhandels ist eben jene Furcht und ein „Näherzusammenrücken“ der „Deutschen“ bis unmittelbar vor und noch während des Ersten Weltkriegs herauszulesen. Seit dem Kriege 1866 begann ein stetiges Zurückgehen des Absatzgebietes für deutsche Literatur. Über die Gründe äußerte sich Wilhelm Müller, ein prominentes Vorstandsmitglied des Buchhändlervereins, folgendermaßen:
Je mehr die nichtdeutschen Völker Österreich-Ungarns ihr Hauptbestreben darin erblickten, sich national zu entwickeln und mehr und mehr selbständig zu werden, und die nationalen Fragen in den Vordergrund traten, desto mehr schränkten sich die Absatzgebiete für deutsche Literatur von selbst ein. Es ist ja allgemein bekannt, daß die Tschechen und Magyaren große materielle Opfer gebracht haben, um eine nationale Literatur zu schaffen und auszugestalten, und man kann wohl auch ohne Übertreibung sagen, daß es beinahe als patriotische Pflicht auch in den intelligenten Kreisen dieser beiden Völker angesehen und betrachtet wird, keine deutschen, sondern nur in ihrer Volkssprache geschriebene Bücher zu lesen.[41]
Das Aufblühen der nationalen Bücherproduktion auf Kosten der österreichischen und deutschen Verleger galt als „ein sehr empfindlicher Schlag“ (Müller, ebda.). Dieses Einengen des Absatzes und des Absatzgebietes war ein Prozeß, der seinen Höhepunkt im Auseinanderfallen des Vielvölkerstaates nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erreichte. Die Folge hievon war laut Müller 1917 in einer Analyse der „Zukunft des deutschen Buchhandels in Österreich-Ungarn“ (loc.cit.), daß die österreichischen Verleger sich immer mehr darauf beschränkten, „nur wissenschaftliche Werke zu verlegen, die nach wie vor auch in Deutschland großen Absatz fanden, während die schöngeistige Verlagstätigkeit fortgesetzt eingeschränkt wurde. Inländische Dichter und Schriftsteller schöngeistiger Richtung suchten mehr und mehr ihre Verleger in Deutschland, und so mehrten sich die Vorwürfe, daß der Unternehmungsgeist der österreichischen Verleger geringer geworden sei“ (ebda.). Statt aber die Urheberrechtsproblematik und die Preßgesetzgebung bei dieser Entwicklung zu würdigen, schließt Müller: „Man bedachte dabei nicht, daß die eben geschilderten politischen Verhältnisse schuld daran seien.“ (ebda.)
Bleiben wir bei der Analyse Müllers. Für die Einschränkung des Verlags schöngeistiger Literatur in Österreich führt Müller noch einen etwas kuriosen Grund an, der nicht gerade für das Image heimischer Verleger spricht. Während der österreichische Sortimentsbuchhändler gewohnt war, den Börsenverein als Mittelpunkt des gesamten deutschen Buchhandels zu sehen und den größten Teil seines Bedarfs an Büchern aus Deutschland über Leipzig zu beziehen – was für die vorhin erwähnten 90 % spricht – , funktionierten die Handelsverbindungen in umgekehrter Richtung weniger gut. Müller meint sinngemäß, daß die österreichische schöngeistige Verlagslandschaft für die deutschen Sortimenter als hinterste Provinz galt. Müllers Replik:
Es ist ja richtig, daß sehr viele in Österreich erschienene Werke, sei es durch den Dialekt, sei es durch Bezugnahme auf heimatliche Verhältnisse eine lokale Färbung tragen, die den deutschen Lesern meist unverständlich ist, aber es hat keinen österreichischen Buchhändler abgehalten, Fritz Reuters Werke zu verkaufen, obwohl sie in plattdeutschem Dialekt geschrieben sind, wie auch Stindes Schriften, obwohl im Berliner Dialekt verfaßt, seinerzeit in Österreich verschlungen worden sind. (ebda., S. 597)
Müller vertritt in seinem Blick auf die „Zukunft“ auch noch die Ansicht, daß der deutsche Buchhandel in Österreich und Ungarn im großen und ganzen mit Ausnahme jenes in den Hauptstädten – nicht mit dem in Deutschland verglichen werden könne: „Seine Lebensbedingungen sind schwieriger, sein Absatz durchschnittlich geringer, als man nach deutschen Begriffen allgemein annehmen zu dürfen glaubt.“ (ebda., S. 598)
Diese Ausführungen Müllers, Ende 1917 mit einem Blick auf „Friedenszeiten“ verfaßt, sind in anderer Hinsicht, und zwar im Hinblick auf die ideologische und politische Ausrichtung der führenden Vertreter des „deutschen“ Buchhandels in Österreich sowohl vor dem Ersten Weltkrieg als auch während der Ersten Republik, interessant. Denn die große Hoffnung Müllers und seiner Gleichgesinnten war, Österreich nach Ende des Weltkriegs als Teil des Deutschen Reichs zu sehen. Selbst nach dem von vielen als „Schandwerk“ empfundenen Vertrag von St. Germain, der im Buchhandel mit den Gebietsabtretungen einen noch größeren Umbruch verursachte und eine Union mit dem Deutschen Reich verbot, wurde der Anschluß für den Bereich Buchhandel als Hoffnungsschimmer gesehen.[42] Ansonsten begnügte man sich damit, im gesamtdeutschen Buchhandel eine Art Satellitenstellung einzunehmen, als eine Art Dependance des reichsdeutschen Verlagswesens zu fungieren. Die Loyalitäten – und das wird in den 30er Jahren auch nach außen hin manifestiert – gingen eindeutig in Richtung Deutsches Reich und nicht in Richtung der vielzitierten „Republik, die keiner wollte“.
Nach diesem Blick auf die politischen Einflüsse auf die Entwicklung des Verlagsbuchhandels in Österreich wenden wir uns konkreter dem Zeitraum 1909 bis 1918 zu, um am Beispiel buchgewerblicher Betriebe, von Buchhandel und Verlag zum Ausgangspunkt am Anfang der Ersten Republik zu gelangen.[43]
a) 1909[44]
Laut Bericht der Handels- und Gewerbekammer war die Lage in der Buchdruckerbranche von Unsicherheit und Stagnation gekennzeichnet. Besonders am Wiener Platz wurde die Konkurrenz des Auslandes durch heimische Verleger und Autoren noch begünstigt. Hinzu kam, daß die Konzessionsvermehrung und die damit verbundenen Gründungen neuer Druckereibetriebe unablässig fortschritten. Dies hatte geringe Auslastung, geringe Exportchancen trotz hohen technischen Standards, eine ungünstige Geschäftslage und einen großen Preisdruck zur Folge. Auch wird vermerkt, daß die Holzschneidekunst ständig zurückgehe und de facto vor der Auflösung stehe, zumal nun das billigere photochemigraphische Verfahren bevorzugt werde. Nicht nur die Verleger, auch die Lithographieanstalten und Spezialdruckereien spürten den mangelnden urheberrechtlichen Schutz. Der Export in Heliogravüren und Faksimileaquarellen speziell nach Rußland verminderte sich, weil mit diesem Land keine literarische Konvention bestand. So waren in den vorangegangenen Jahren in Rußland leistungsstarke Kupferdruckereien entstanden, die die marktgängigen Artikel österreichischer und deutscher Verleger nachahmten und entsprechend billig auf den Markt brachten. Im Bericht 1909 wird für den Bereich „Buchhandel“ lediglich auf Probleme der Schulbücherverleger hingewiesen.
b) 1910[45]
Für das Jahr 1910 konnte man vermelden, daß der Buch-, Kunst- und Musikalienhandel neuerlich einen Aufschwung genommen habe, obwohl in Wien keine besonders hervorragenden Werke publiziert worden wären. Im Bereich österreichischer Verlag wird folgendes festgehalten:
Der wissenschaftliche (medizinische, juridische, technische) Verlag entwickelt sich in mäßigem Tempo. Im belletristischen Verlag drückt sich die Vorherrschaft von Berlin und Leipzig immer stärker aus. Es ist wiederum ein Berliner Verlag entstanden, der, offenbar mit großer Kapitalskraft ausgerüstet, mit Vorliebe Wiener Autoren bringt und für den Vertrieb dieser Werke eine große Agitation entfaltet. Eine Leipziger Verlagsfirma spezialisiert sich geradezu für die Werke österreichischer Autoren, und es ist ihr gelungen, die erfolgreichsten an sich zu fesseln.[46]
Es war für den Sortimentsbuchhandel ein ruhiges Geschäftsjahr. In der Belletristik gab es keine Sensation, und die Vorliebe des Publikums für gediegene Literatur dauerte an.
c) 1911[47]
Im Bericht der n.ö. Handels- und Gewerbekammer für 1911 heißt es, daß der Bücherkonsum weiterhin eine aufsteigende Richtung aufwies. Der Absatz sei im Wachsen, der Umsatz für die Händler allerdings nicht. Es zeichnete sich eine Tendenz ab, möglichst billige Bücher zu kaufen. Außerdem wird vermerkt, daß – im Gegensatz zur heimischen – die Druck- und Verlagsindustrie Deutschlands einen so hervorragenden Aufschwung genommen habe, daß sie sowohl Klassikerausgaben als auch moderne Schriftsteller „um einen unglaublich billigen Preis herstellen“ könne. Vergleichbares läßt sich in Österreich nicht feststellen. Die Vormachtstellung reichsdeutscher Verlage auf dem österreichischen Markt wird weiter ausgebaut. Und was wenigstens den „Konsum“ des „österreichischen“ betrifft, so kann man ehrenrettend zumindest auf die Tatsache hinweisen, „daß auf belletristischem Gebiet in Wien von allen Schriftstellern am meisten österreichische Autoren beliebt sind“. Führend in der Publikumsgunst: Bartsch, Ertl, Greinz, Hermine Cloeter, Wassermann, Decsey, Rosegger. Aber so gut wie alle deren Werke sind in Deutschland, entweder bei Staackmann (Leipzig) oder bei S. Fischer (Berlin) herausgekommen.
Es gibt aber auch von der Verlagsfront Berichtenswertes:
Am Ende des Berichtsjahres wurde neuerlich ein Versuch gemacht, einen belletristischen Verlag in Österreich zu schaffen. Die ersten Werke, die die neue Firma auf den Markt brachte, stammten durchweg von hervorragenden österreichischen Schriftstellern und fanden in Ausstattung und Inhalt großen Beifall. Es kann jedoch nicht verhehlt werden, daß es große Schwierigkeiten bietet, die starke Konkurrenz der reichsdeutschen Verleger zu schlagen, die infolge ihrer Kapitalskraft in der Lage sind, auch den österreichischen Autoren sehr bedeutende Honorare zu zahlen.
Der neue belletristische Verlag ist der im November 1911 gegründete „Artur Wolf Verlag“. Ob höhere Honorare dafür ausschlaggebend waren, daß die österreichischen Autoren sich reichsdeutsche Verlage aussuchten, kann zumindest angezweifelt werden.
d) 1912[48]
Ende 1912 begann sich die Kriegsangst auf das Buch- und Verlagswesen in Österreich auszuwirken. Die zahlreichen Einberufungen zwangen die Käufer immer mehr zur Sparsamkeit, was sich beim Buchabsatz bemerkbar machte. Trotzdem erfuhr das Buchgeschäft in diesem Jahr durch zwei Dichterjubiläen einen Anstoß, und zwar aus Anlaß des 50. Geburtstags von Gerhart Hauptmann und Arthur Schnitzler. Dieser Anlaß wurde bekanntlich vom Verleger S. Fischer – „(in Berlin, denn auch der echt wienerische Schnitzler wird in Berlin verlegt – eine Inkongruenz, mit der man sich abfinden muß) – zur Veranstaltung einer Gesamtausgabe benutzt, die großen Anklang fand. Gern gekauft wurden außerdem die Österreicher: Bartsch, Ginzkey, Greinz, Salburg und Strobl (alle Staackmann, Leipzig). „Auf dem Verlagsgebiete“, heißt es im Bericht für das Jahr 1912,
spielt der österreichische Buchhandel nur eine bescheidene Rolle. Leider muß konstatiert werden, daß die Interesselosigkeit, mit welcher das österreichische Sortiment dem österreichischen Verlag begegnet, noch immer dieselbe ist, hingegen kann beobachtet werden, daß die guten Erscheinungen des österreichischen Fachverlages im Auslande erfreulicherweise immer mehr Beachtung finden und der Absatz solcher Artikel nach Deutschland eine ganz enorme Steigerung erfahren hat. Ob der Versuch, den eine neugegründete Wiener Verlagsfirma mit schönwissenschaftlichem Verlage macht, gelingen wird, läßt sich noch nicht sagen.
Man ersieht aus diesem Bericht, daß belletristische Verlage, vor allem Neugründungen, gewissermaßen als Exoten betrachtet wurden.
e) 1913[49]
Für 1913 weiß die Handels- und Gewerbekammer „von der schweren Krise des wirtschaftlichen Lebens“ zu berichten, von der sich der Buch-, Kunst- und Musikalienhandel erhole. Der Krieg wirft bereits seinen Schatten voraus. Im Bereich Verlagsbuchhandel läßt sich „keine wesentliche Veränderung“ vermelden. Trotz Wirtschaftskrise ist von einer erheblichen Steigerung der Bücherproduktion die Rede sowie davon, daß der Bücherbedarf des Publikums weiterhin eine steigende Tendenz aufweise. Besonders der literarisch am besten gebildete Teil der Bücherkäufer – für andere Bevölkerungsschichten war der Buchkauf sicherlich im Budget nicht drinnen – bevorzugte, laut Bericht, Memoiren und Briefliteratur. Zu den 1913 in Österreich begehrten Schriftstellern gehörten etwa Bartsch, Ertl, Ginzkey, Greinz, Müller-Guttenbrunn, Schnitzler und Strobl.
Unter den außerösterreichischen Autoren wurden die Romane von Thomas Mann „stark verlangt“. Auch die vielbändigen, billigen und ausschließlich aus dem Deutschen Reich (etwa „Insel-Verlag“) importierten Sammlungen bauten ihren Marktanteil aus und fanden „ungeahnten Absatz“. österreichische Konkurrenz haben sie weiterhin nicht zu fürchten. Erst nach Ende des Ersten Weltkriegs finden sich vereinzelt entsprechend risikofreudige Verleger in Österreich.
f) 1914 -1918 Der Weltkrieg[50].
Es war die katastrophale Situation in den Zweigen Druckerei, Verlag und Buchhandel, die sich während des Ersten Weltkriegs entwickelt hatte, mit der sich die gesamte Branche in der neuen Republik konfrontiert sah. Deshalb wollen wir die Lage der Kriegsjahre etwas genauer ansehen. Als paradigmatisch für die Verschlechterung im Verlagsbuchhandel im allgemeinen kann wohl die Lage in den buchgewerblichen Betrieben gelten.
Während noch bis Ende des ersten Kriegsjahrs die meisten Grundstoffe und Materialien zu fast normalen Preisen zu haben waren, setzten im Jahre 1915 bereits ganz erhebliche Teuerungen ein. Viele dieser Materialien – von Papier bis zur Druckerschwärze und von Benzin bis zu Kohle und Koks – waren zu entsprechenden Preisen nur mehr im Schleichhandel erhältlich. Eine Übersicht über die Preissteigerungen einiger für die Aufrechterhaltung der Betriebe unbedingt notwendigen Materialien ergibt, daß jeweils zwischen 1914 und 1918 der Kilopreis für holzfreies Papier um das 10fache anstieg, Farben um das 5fache, Benzin – später nur mehr über Schleichhandel erhältlich – um das 14fache, Glyzerin um das 18- bis 27fache auf dem schwarzen Markt, Spiritus um das 10fache usw.[51]
Das größte Problem der Buchdruckereien während des Kriegs (aber auch nachher) war die Papierbeschaffung. Es wird z.B. berichtet, daß es Monate in den Jahren 1917 und 1918 gab, in denen auf normale Weise nicht ein Bogen Papier aufzutreiben war. Es gab freilich Papier genug, wenn man bereit war, es von Schleichhändlern zu einem entsprechend hohen Preis zu beziehen.
Kurz nach dem Ausbruch des Kriegs war – was auf eine niedrige Verlagsproduktion hinweist – die Auslastung der meisten Druckereien derart schlecht, daß viele Betriebe, um keine Entlassungen vornehmen zu müssen, Kurzarbeit einführten. Es wurde also nur die halbe Woche gearbeitet. Ein weiteres Problem bereitete den Druckereien der Mangel an Fachkräften wegen der vielen Einberufungen vor allem ab Anfang 1915. Zudem boten die großen Kriegsbetriebe geschultem Personal höhere Löhne.
Auch die Wochenlöhne der Buchdrucker stiegen in den fünf Jahren zwischen 1914 und 1918 an. Diese Lohnerhöhungen trugen zwangsläufig zu Preissteigerungen bei Drucksorten und Ähnlichem bei. So verdiente ein Buchdruck-Maschinenmeister 1914 40 Kronen in der Woche, eine Einlegerin 18 Kronen. 1917 waren es dann 62 Kronen resp. 20 Kronen. Im letzten Kriegsjahr verdiente der Buchdruck-Maschinenmeister 110 Kronen die Woche, also um das 2 3/4fache, die Einlegerin 50 Kronen, also um ungefähr das Zweifache mehr. Nur wenn man einen Blick auf die Kleinhandelspreise wichtigster Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, also auf den „Warenkorb“, für den gleichen Zeitraum wirft, ergibt sich ein wahrhaft tristes Bild.
So stiegen die Kosten des vierwöchigen Lebensmittelverbrauches einer Wiener Arbeiterfamilie in den Jahren 1914 bis Anfang 1918 um das 8fache (Index Juli 1914 = 100; zu Beginn 1918 = 828). Zu Beginn des Jahres 1919 war der Warenkorb vom Juli 1914 gar 28,54 mal teurer.[52] Lohnsteigerungen konnten – wie unser Beispiel zeigt – nicht entfernt Schritt halten.
Und wie verhielten sich Buchpreise zu den Löhnen in dieser Branche? Dazu einige ausgewählte Beispiele. Anfang 1918 kostete ein Band der im Ed. Strache Verlag erschienenen Novellen von Alfons Petzold, Von meiner Straße (Umfang 197 S.) 7,60 Kronen, Leopold Lieglers im Verlag der Buchhandlung Richard Lányi erschienenes Werk Karl Kraus und die Sprache 1,50 Kronen. Eine Folge der Illustrierten-Monatsschrift Donauland kostete 3 Kronen, eine Mappe mit Zeichnungen von Egon Schiele, die 1917 im Verlag der Buchhandlung Richard Lányi erschien, 45 Kronen, also fast die Hälfte von dem, was ein Buchdruck-Maschinenmeister zur selben Zeit in der Woche verdiente. Einzelhefte der Reihe „Konegens Kinderbücher“ waren hingegen relativ billig. So war jede Nummer um 40 Heller zu kaufen.
Von den größeren Städten Österreichs, deren Kleinhandelspreise statistisch erhoben wurden, war Wien allgemein am teuersten. Anhand von vielen einzelnen Beispielen sah die Entwicklung folgendermaßen aus: 1 Kilogramm Mehl, das im Juli 1914 um 4,27 Kronen zu kaufen war, kostete 1918 im freien Handel gleich 31,20 Kronen.[53]Ein Ei kostete 1914 2,51 Kronen, Anfang 1918 hingegen bereits 71,60 Kronen. Und nicht nur die Grundnahrungsmittel, auch Bekleidung, Gas, elektrischer Strom usw. waren um ein Mehrfaches im Preis gestiegen. Wie wir an späterer Stelle zu vermerken haben werden, wurde (in der Werbung) sowohl vom Buchhandel wie auch vom Verlag argumentiert, daß trotz gewaltiger Teuerungen Bücher – in der Relation – sogar billiger geworden seien.
Um das Bild in der Druckerbranche abzurunden, sei noch auf einige weitere Erschwernisse hingewiesen, die sich letzten Endes auch auf Buch- und Verlagsbuchhandel auswirken mußten. So wurde erstmals im Jahre 1916 eine „Bleiabgabe“ eingeführt. Das heißt: 15% der Bleibestände mußten an die Metallzentrale abgeliefert werden, von der das Unternehmen vergütet wurde. Besonders neuere Unternehmungen mittleren und kleineren Umfangs waren von dieser Maßnahme betroffen. Drucksortenaufträge für den Staat (etwa Kriegsministerium) wurden den Privatunternehmen weggenommen und an die Staatsdruckerei vergeben.
Neben dem Papiermangel war es auch um die Qualität schlecht bestellt. Die Papierfabriken konnten den Bedarf nicht mehr decken, und viele Sorten wurden wegen Mangels an Rohmaterial erst gar nicht mehr erzeugt Wer sich von der Papier- und Druckqualität dieser Zeit am Beispiel Rotations- (Zeitungs-)papier überzeugen möchte, braucht nur eine jener durch Krieg und Papiermangel im Umfang stark verminderten Zeitungen, die in Wien erschienen, zur Hand zu nehmen.
Die Zeit des Kriegs war auch für den Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhandel „eine überaus schwere“.[54] Auch in dieser Sparte gab es Probleme mit den steigenden, aber nicht entfernt die Inflation abgeltenden Lohnabschlüssen. Für den Buchhandel begann sich die einseitige Importabhängigkeit von reichsdeutschen Verlagswerken zu rächen. Denn zum einen verteuerten sich – durch die Inflation im Inland – die Valuta, mit denen der österreichische Sortimenter seine Bücherimporte letztlich bezahlte, zum anderen schwankte der Markkurs, und die Mark war eben die Währung, in der Preise ausgezeichnet waren. So wurde der Bezug ausländischer Bücher zu einem einigermaßen teuren Lotteriespiel. Durch die fixen Ladenpreise kam es infolge des Markkurses und der Valutaschwankungen zu ungewohnten Preisverschiebungen im Handel. Aber noch eines trug zur Verteuerung der Bücher, die „noch eine verhältnismäßig billige Ware“ darstellten, bei, nämlich der sog. „Teuerungszuschlag“, der auf 20% des Ladenpreises erhöht wurde und für eine unübersichtliche, um nicht zu sagen chaotische Preisgestaltung sorgte. Mit dem „Teuerungszuschlag“, der sich auch dauernd änderte, fanden Buchhändler beim Publikum geringes Verständnis. Das Problem blieb noch bis in die 20er Jahre hinein, bis zur Währungsstabilisierung höchst aktuell.
Der deutschösterreichische Verlagsbuchhandel wurde, wie zu erwarten war, durch den Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogen. Besonders betroffen war der auf Wissenschaft ausgerichtete Verlag. Das lag z.B. an der Schwierigkeit, sich geeignetes Papier, geschweige denn Rohmaterial, besonders für die Einbände, zu beschaffen. So passierte es, daß vielbegehrte Werke, nachdem sie einmal vergriffen waren, aus den genannten Gründen nicht mehr neu aufgelegt werden konnten. Die „neuen“ Herstellungskosten machten sie zu einem unrentablen Geschäft.
Über den schöngeistigen Verlag 1914-1918 wird folgendes berichtet:
Der belletristische Verlag, der in Deutschösterreich aber nie sehr entwickelt war, hat unter diesen Schwierigkeiten weniger zu leiden gehabt, da bei diesem die Verkaufspreise nicht die Rolle spielen wie bei wissenschaftlichen Werken und Schulbüchern, welch letztere bekanntlich der Genehmigung der Unterrichtsbehörde bedürfen.
Leider kann nicht unerwähnt bleiben, daß alle diese Mißstände, die den regelrechten Geschäftsbetrieb während des Krieges so sehr erschwerten oder teilweise unterbanden, seit dem politischen Zusammenbruch in noch weit höherem Maße fortbestehen und insbesondere durch die unheimlich steigenden Geschäftsspesen (Gehalte, Löhne, Transportkosten usw.) manches Unternehmen bereits an den Rand seiner Ertragsfähigkeit gebracht haben. Da das Arbeitsgebiet des deutschösterreichischen Verlages durch die politischen Umwälzungen ganz wesentlich eingeschränkt wurde, sind dessen Aussichten in die Zukunft keine erfreulichen. (a.a.O., S. 865)
Mit dieser „Zukunft“ werden wir uns nun zu befassen haben, aber zuerst versuchen wir, einen Überblick über die Verlagslandschaft in Österreich vor 1918 anhand von ausgewählten Beispielen zu geben.
Anmerkungen
[38] Die folgende Darstellung stützt sich im wesentlichen auf die diesbezüglichen Ausführungen des Vorsitzenden der österreichisch-ungarischen Buchhändler, WILHELM MÜLLER, Der österreichische Buchhandel. (Aus der anläßlich des 25jährigen Bestandes des Fachtechnischen Klubs der Beamten und Faktoren der k.k. Hof- und Staatsdruckerei 1886-1911 herausgegebenen Festschrift.) Abgedruckt in: BC, Nr. 38, 18. September 1912, S. 530-531 und ebda., Nr. 39, 25. September 1912, S. 544-546 und: Die Zukunft des deutschen Buchhandels in Österreich-Ungarn. (Abdruck aus dem Börsenblatt Nr. 272, 22. November 1917), in- BC, Nr. 49, 5. Dezember 1917, S. 597-599.
[39] Wie wir an späterer Stelle sehen werden, war der supranationale Charakter des Börsenvereins der entscheidende Grund, weshalb er nach 1933 in die Kammerwirtschaft der Nazis à la longue nicht integriert werden konnte.
[40] Adreßbuch für den Buch-, Kunst- und Musikalienhandel und verwandte Geschäftszweige. Hrsg. von MORITZ PERLEs k. u. k. Hofbuchhandlung, 52. Jg., 1918, S. V. Hier die Aufschlüsselung: Buchhandel: 2861, davon 760 Verlagshandlungen. Kunsthandel: 982, davon 51 Verlagshandlungen. Musikalienhandel: 1185, davon 84 Verlagshandlungen.
[41] Siehe Anm. 38. BC, Nr. 49, 5. Dezember 1917.
[42] Man braucht nur die Protokolle diverser Vereinssitzungen, vor allem aus den frühen 20er Jahren, durchzulesen. Um aber ein konkretes Beispiel anzuführen, sei auf ADOLF STIERLE (zit. Anm. 1, S. 41) verwiesen: „Als zweite wichtige Frage nannte ich die Möglichkeit eines eventuellen Anschlusses an das Deutsche Reich. Wenn nun ein Anschluß kommen sollte, so würde es vom Verhältnis abhängen, in dem Wien und Berlin zueinander stehen würden, nach welcher Richtung sich Wien im deutschen Buchhandel entwickeln könnte. Wenn sich ein gedeihliches Zusammenarbeiten fände, so wäre gegenüber der kommerziellen Zentrale Berlin Wien vielleicht in der Lage, das Zentrum für Kunst, Musik, Theater, Humanitäres und manche schon jetzt dort gepflegte Gebiete der Wissenschaft zu vertreten. Sollten (sic!) sich aber Wien und Berlin gegenseitig befeinden und Konkurrenz machen wollen, so würde Wien wahrscheinlich zur Rolle einer deutschen Provinzstadt herabsinken, das heißt mit anderen Worten, seine heutige Stellung im deutschen Buchhandel verlieren. Im übrigen würde es nur noch von der politischen Stellung Wiens in Groß-Deutschland, von seinem politischen Einflusse abhängen und wenn dieser unbedeutend bliebe, so könnte man einzelnen Zweigen des Wiener Verlages beinahe das Todesurteil sprechen.“ Stierle veröffentlichte diese Gedanken 1928.
[43] Die zugleich detaillierteste und zuverlässigste Unterlage in dieser Hinsicht bilden die „Berichte der n.ö. Handels- und Gewerbekammer“. Auf sie wird im folgenden einzeln verwiesen.
[44] Bericht über die Industrie, den Handel und die Verkehrsverhältnisse in Niederösterreich während des Jahres 1909. Dem k.k. Handelsministerium erstattet von der Handels- und Gewerbekammer in Wien. Wien 1910, S. 446-450.
[45] Zitiert nach „Buch-, Kunst- und Musikalienhandel“, in: BC, Nr. 32, 9. August 1911, S. 408 f.
[46] Im Fall des Berliner Verlags könnte es sich um den „Ernst Rowohlt Verlag“ handeln, der am 30. Juni 1910 ins Handelsregister eingetragen wurde. Im Fall der Leipziger Firma dürfte es sich um den „Insel-Verlag“ handeln.
[47] Bericht für das Jahr 1911. Teilabdruck „Buch-, Kunst- und Musikalienhandel“, in: BC, Nr. 45, 6. November 1912, S. 642 f.
[48] Bericht für das Jahr 1912. Teilabdruck „Buch-, Kunst- und Musikalienhandel“, in: BC, Nr. 37, 10. September 1913, S. 496-498.
[49] Bericht über die Industrie, den Handel und die Verkehrsverhältnisse in Niederösterreich während des Jahres 1913. Dem k.k. Handelsministerium erstattet von der Handels- und Gewerbekammer in Wien. Wien 1914, S. 560-563.
[50] Bericht über die Industrie, den Handel und die Verkehrsverhältnisse in Niederösterreich während der Jahre 1914-1918. Dem Staatsamte für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten erstattet von der n.ö. Handels- und Gewerbekammer in Wien. Wien 1920, S. 854-869.
[51] Diese Feststellungen ergeben sich aus der Übersicht im Bericht für 1914-1918, S. 855. Die weiter unten angeführten Lohnverhältnisse finden sich ebda., S. 857.
[52] Laut amtlicher Statistik. Statistisches Handbuch für die Republik Österreich. Hrsg. vom Bundesamt für Statistik. II. Jg., Wien 1921, XIV. Preise. 3. Die Kosten des vierwöchentlichen Lebensmittelverbrauches einer Wiener Arbeiterfamilie in den Jahren 1914-1921, S. 102.
[53] Ebendort.
4. Die Verlagslandschaft in Österreich vor 1918
Im Jahre 1835 schrieb der bekannte Wiener Schriftsteller und Buchhändler Franz Gräffer (6.1.1785-8.10.1852) in der von ihm herausgegebenen Österreichischen National-Encyclopädie folgendes zum Zustand des österreichischen Buchhandels zu dieser Zeit:
Der österreichische Buchhandel verhält sich zum Ausland durchaus passiv, besonders seit dem (was an und für sich längstens schon wünschenswert gewesen) der Nachdruck hat aufhören müssen. In den sogenannten sciences exactes, wie in der Medicin, steht er wohl im Gleichgewicht; aber für Philologie, Philosophie, Geschichte, Politik, schöne Literatur, Zeitschriften, Taschenbücher und für generelle Werke, wie z. B. das Conversations-Lexicon, gehen sicherlich Hunderttausende von Thalern in das Ausland, denn die im Inlande erscheinenden Artikel dieser Fächer finden im Ganzen nicht sehr viele Käufer.[1]
In den folgenden achtzig Jahren wanderten viele „Hunderttausende von Thalern in das Ausland“, vornehmlich in das Deutsche Reich, denn bereits vor der Jahrhundertwende machten Bücherimporte aus Deutschland 90% der Gesamteinfuhr nach Österreich aus. Aber im selben Zeitraum kam es zu unzähligen Verlagsneugründungen in Österreich. Nur blieben die Verlagsrichtungen einigermaßen beschränkt. So schreibt Carl Junker 1921 rückblickend, daß „von verhältnismäßig wenigen, wenn auch vortrefflichen und rühmenswerten Ausnahmen abgesehen, der Verlagsbuchhandel in Wien und in den wenigen anderen großen deutschen Orten der sogenannten im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder [sich] in erster Linie auf folgenden Gebieten (betätigte): Schulbücher[2] 56), wissenschaftliche, insbesondere medizinische Werke und Austriaca“ (Der Verlagsbuchhandel, S. 2). Ähnlich äußerte sich Johannes Eckardt 1919 in seiner Analyse des deutschösterreichischen Buchhandels:
Dabei soll nicht verschwiegen werden, daß einige dieser Verlagsversuche wirklich auch großzügig ans Werk gingen, und daß Spezialgebiete – Theologie, Medizin, Jus – auch in Österreich tüchtige Fachverlage fanden. (a.a.O., S. 234)
Österreich war also ein Land der Schulbücher-, Kalender- und Fachverlage. Der deutsch-österreichische Verlegerstand konnte nach Ansicht Hermann Gilhofers im Jahre 1910 „neben dem imponierenden reichsdeutschen Verlagsbuchhandel, dessen zwar kleinerer, aber ebenbürtiger Freund und Bruder er ist, mit allen Ehren bestehen und sich zeigen“.[3] Nur dürfe „an der bedauerlichen Tatsache nicht vorübergegangen werden, daß zwei ganz besonders belangreiche Arbeitsfelder verlegerischer Wirksamkeit bei uns nahezu gänzlich brachliegen“. (ebda.) Und mit einem dieser „Arbeitsfelder“, dem belletristischen Verlag, befassen wir uns hier ganz besonders. Wie wir bereits ausführlich dargestellt haben, war die Urheberrechtsgesetzgebung und die Weigerung Österreich-Ungarns, der Berner Convention beizutreten, ein entscheidendes Hemmnis in der Entwicklung eines belletristischen Verlags, und an zweiter Stelle war die rigorose Zensur schuld, die das Verlegen von schöngeistiger Literatur zum risikoreichen Geschäft machte. Es ist daher kaum verwunderlich, daß selbst bis in die Jahre vor 1918 eine solche Verlagsneugründung in der Branche mit derselben Neugier verfolgt wurde wie ein Schwimmanfänger, der sich ins tiefe Wasser wagt. Wird er überleben? In seiner Analyse der Entwicklung des Verlagsbuchhandels in Österreich machte sich Gilhofer Gedanken über die Gründe:
Nach wie vor sehen wir unsere ersten dichterischen Talente den Weg ins Ausland gehen und ihre geistigen Schöpfungen aus Leipzig, Berlin, Stuttgart, München usw. wieder zu uns einwandern. In jeder Buchhandlung ist sicherlich oft und oft die Frage erörtert worden, ob denn das so sein und bleiben müsse. Die Antwort ist jedesmal ein bedauerndes Achselzucken oder das alte, lahme: nemo propheta in patria. An opferwilligen Versuchen, diesem vielbeklagten Übelstände abzuhelfen, hat es nicht gefehlt, doch ist es eben in mehreren Fällen, gerade aus neuerer Zeit, immer nur beim Versuche geblieben und es fehlt uns auch heute noch an einem kapitalkräftigen und energischen Unternehmer, der die zahlreichen und hochbegabten Kräfte dichterischen Schaffens im Lande festzuhalten vermochte.
Mögen hier vorwiegend die vorhin angedeuteten Vorurteile, dann Ursachen materieller Natur und der Wunsch der jungen Talente, sobald als möglich in einem bereits erfolgreichen belletristischen Verlage unterzukommen, mitwirken, so ist es aber ganz unerklärlich, daß das Feld der Bilderbücher und Jugendschriftenliteratur bei uns noch so gut wie unbebaut geblieben ist. (a.a.O., S. 45)
Österreich war also bis 1918 – und seit etwa 1860 – ein Land ohne einen namhaften belletristischen Verlag von Dauer, was nicht heißt, um das Apodiktische an dieser Feststellung etwas abzuschwächen, daß bestehende Verlage nicht gelegentlich Belletristik produzierten oder daß man überhaupt keine Beispiele für belletristische Verlage anführen kann.
Auffallend war auf dem österreichischen Markt nach der Jahrhundertwende die starke Präsenz von reichsdeutschen belletristischen Verlegern wie etwa Insel, Staackmann und S. Fischer. Das Jahr 1918 war für den Verlagsbuchhandel in Österreich in vielerlei Hinsicht eine Zäsur. Ein auffallendes Merkmal der Verlagslandschaft im Österreich des 19. Jahrhunderts und der ersten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts war, daß bis auf wenige Ausnahmen, ja gar zu 99%, die Gründer von Verlagen (in Wien) „Zugereiste“ waren und in der Regel aus dem Deutschen Reich eingewandert waren. Um nur ein paar Namen zu nennen: Leykam, Manz, Deuticke, Szelinski, Gerold, Seidel, Halm, Weinberger, Fromme, Meyerhoff und Frick kamen aus dem Deutschen Reich nach Wien, A. Hartleben aus Budapest, Moritz Perles aus Prag. Ähnlich verhielt es sich mit den Gründern von größeren und kleineren Druckanstalten, wobei man bloß die Namen Eberle, Fromme, Jasper, Gerold, Gistel, Holzhausen, Reisser, Frisch nennen muß.
Nach 1918 wurde der aus Deutschland gebürtige Verleger-Buchdrucker, der „Auch-Verleger“, dann bei Neugründungen fast schlagartig vom einheimischen Unternehmer und Nur-Verleger abgelöst. Und: waren die Gründer des 19. Jahrhunderts großteils aus Deutschland gebürtige Buchhändler evangelischer Konfession, so waren die meisten Nur-Verleger im Österreich der jungen Ersten Republik vielfach „branchenfremd“ und mosaischer Konfession. Nach 1918 waren die Gründer nicht immer aus dem Buchhandel – Lehrling, Gehilfe usw. – hervorgegangen, und hier scheinen die Gewerbebestimmungen hinsichtlich des „Befähigungsnachweises“ etwas lockerer gehandhabt worden zu sein. Oft fand man einen „Konzessionsinhaber“, womit also den Bestimmungen Genüge getan wurde.
Um nun die nach 1918 auftretende komplette Umwandlung der Verlagslandschaft in Österreich kenntlich zu machen, wird an Hand einer Reihe von österreichischen Verlagen, die in der Regel im 19. Jahrhundert gegründet wurden, gezeigt, welches Spektrum hier vorhanden war. Dazu sind, um Mißverständnissen vorzubeugen, einige Bemerkungen notwendig. Auf Vollständigkeit kann und soll kein Anspruch erhoben werden, und in diesen Darstellungen wird man den einen oder anderen Verlag mit Sicherheit vermissen. Es soll nur die Erkenntnis gewonnen werden, welche Verlagsarten es gegeben hat und welche Programmrichtung sie eingeschlagen haben, schließlich soll unsere Behauptung untermauert werden, daß vor 1918 das Gebiet der belletristischen Verlage eine ziemlich unterentwickelte Sparte war. Meist wird die Entwicklung nur bis 1918 verfolgt, in einzelnen Fällen aber auch bis in die heutige Zeit.
Abgeschlossen werden diese kurzen Abschnitte mit einer knappen Firmengeschichte eines unmittelbar vor der Jahrhundertwende gegründeten Verlags, der ausschließlich schöngeistige Literatur produzierte und den Versuch unternahm, österreichische Autoren und Schriftsteller in einem heimischen Verlag unterzubringen, nämlich des Wiener Verlags.
a) Artaria & Co. (Kunstverlag, Kunsthandlung, Kunstantiquariat, Landkartenhandlung und kartographischer Verlag in Wien)
Die seit 1770 in Wien bestehende Firma gilt als die älteste Kunsthandlung in Österreich und als eine der ältesten Firmen Wiens überhaupt. Trotz des italienischen Namens waren die Artarias ein altes Wiener Patriziergeschlecht. Der Stammvater Giovanni (1725-1797) war um die Mitte des 18. Jahrhunderts nach Wien gekommen, wo seine Neffen Carlo (1747-1808) und Francesco (1744-1808) sowie dessen Sohn Domenico (1765-1823) Gründer des Wiener Hauses wurden. In der folgenden Generation wurde das Unternehmen von August Artaria (1807-1893) weitergeführt, der nach einer fast 60jährigen Tätigkeit 1893 starb. Die Söhne Carl August (1855-1919) und Dominik IV (1859-1936) traten im Jahre 1881 bzw. 1890 in das väterliche Geschäft ein und wurden dessen Besitzer. Das Geschäftslokal selber, das nach einem Neubau 1901 auch zu Ausstellungszwecken wesentlich vergrößert wurde, befand sich seit 1789 im Haus Kohlmarkt 9. Nach dem Tode von Carl August Artaria am 29. März 1919 traten die Söhne Franz (1860-1942) im Mai 1920 und August (1894-1932) im Jänner 1922 als Mitbesitzer in die Firma ein.
Artaria & Co. betrieb drei Handels- und Verlag zweige: eine Kunstabteilung, eine Musikalienabteilung (ab Oktober 1776, und bald darauf einen Musikverlag) und eine kartographische Abteilung (Kartenvertrieb ab 1776). Die erste Sparte umfaßte das Kunstgeschäft und den Kunstverlag-von Kupferstichen, Ansichtenserien, Porträts, Originalradierungen usw. 1778 erschienen die ersten Werke im Musikverlag Artaria. Man verlegte Joseph Haydn, Mozart, Schubert und natürlich Beethoven. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Kunstverlag eingeschränkt, und im Oktober 1894 wurde der gesamte Musikverlag an den Musikverleger Josef Weinberger verkauft.[4]
Im Mai 1920 kam es zu einer Abspaltung der Landkartenabteilung von Artaria. Diese wurde als Tochterunternehmen an die Kartographische Anstalt G. Freytag & Berndt angegliedert. übrig blieb „Artaria & Co., Kunsthandlung, Kunstverlag und Kunstantiquariat“. Was die Produktion des Kunstverlags betrifft, so muß die vielbeachtete Monatsschrift des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, Kunst und Kunsthandwerk, die seit 1898 von Artaria herausgegeben wurde, erwähnt werden.
Im November 1922 vereinigten sich Artaria & Co. und der Kunsthändler Gustav Nebehay zu einer Interessengemeinschaft. Zehn Jahre später wurde beschlossen, die Kunsthandlung Artaria & Co. zu verkaufen bzw. zu liquidieren. Im Jahre 1931 erfolgte dann die Liquidierung. Eine Folgefirma, Artaria & Co. Nachf. Gilbert Schiviz, wurde am 9. Oktober 1934 ins Handelsregister in Wien eingetragen. Diese besteht heute noch im Haus Kohlmarkt 9.
Im Jahre 1940 wurde schließlich die Firma Geographischer Verlag und Landkartenhandlung Artaria Ges. in. b. H. mit der Kartographischen Anstalt Freytag-Berndt A.G. fusioniert. Die Firma hieß nun: Kartographische Anstalt Freytag-Berndt und Artaria K.G. Seit Juli 1964 lautet der handelsgerichtlich eingetragene Firmenname: Freytag-Berndt und Artaria K.G., Kartographische Anstalt.[5]
b) Anton Schroll & Co. (Kunstverlag)
 Die Firma Anton Schroll & Co. wurde am 17. Jänner 1884 durch Anton Schroll (30.5.1854, Galizien-6.11.1919, Graz) in Wien begründet. Die ersten Werke, die im Gründungsjahr noch herausgegeben wurden, blieben längere Zeit bestimmend für den Aufbau des Unternehmens: Architektur und Kunstgewerbe. So begann die Verlagsproduktion mit einer Veröffentlichung über Architektur und Kunstgewerbe des Barocks zur Zeit Maria Theresias. Diese und ähnliche Publikationen, die primär dem Baukünstler dienen sollten, blieben zunächst das Hauptgebiet des Verlags. Nach der Jahrhundertwende und mit Beginn der „Wiener Moderne“ sammelten sich Architekten und Künstler wie z.B. Otto Wagner, Josef Hoffmann) Kolo Moser und Josef M. Olbrich um die von Schroll gegründeten Zeitschriften. Es war dies die Zeitschrift Der Architekt (1895-1914), der später mit der zunehmenden Bedeutung der Innenarchitektur eine zweite, Das Interieur (1900-1915), zur Seite trat. Heute bilden diese Zeitschriften eine reiche Materialsammlung und ein Repertorium für die Entwicklungsgeschichte der neuen Baukunst. Die ebenfalls bei Schroll erschienene Zeitschrift Die bildenden Künste (1918-1922) zählte auch in Deutschland zu den führenden Kunstzeitschriften.
Die Firma Anton Schroll & Co. wurde am 17. Jänner 1884 durch Anton Schroll (30.5.1854, Galizien-6.11.1919, Graz) in Wien begründet. Die ersten Werke, die im Gründungsjahr noch herausgegeben wurden, blieben längere Zeit bestimmend für den Aufbau des Unternehmens: Architektur und Kunstgewerbe. So begann die Verlagsproduktion mit einer Veröffentlichung über Architektur und Kunstgewerbe des Barocks zur Zeit Maria Theresias. Diese und ähnliche Publikationen, die primär dem Baukünstler dienen sollten, blieben zunächst das Hauptgebiet des Verlags. Nach der Jahrhundertwende und mit Beginn der „Wiener Moderne“ sammelten sich Architekten und Künstler wie z.B. Otto Wagner, Josef Hoffmann) Kolo Moser und Josef M. Olbrich um die von Schroll gegründeten Zeitschriften. Es war dies die Zeitschrift Der Architekt (1895-1914), der später mit der zunehmenden Bedeutung der Innenarchitektur eine zweite, Das Interieur (1900-1915), zur Seite trat. Heute bilden diese Zeitschriften eine reiche Materialsammlung und ein Repertorium für die Entwicklungsgeschichte der neuen Baukunst. Die ebenfalls bei Schroll erschienene Zeitschrift Die bildenden Künste (1918-1922) zählte auch in Deutschland zu den führenden Kunstzeitschriften.
Zu diesen Publikationen traten bald auch solche kunstwissenschaftlichen Charakters. Die Struktur der Firma änderte sich im Jahre 1913. Gründer Anton Schroll trat in den Ruhestand, verlegte seinen Wohnsitz nach Graz und übertrug die Firma an eine Ges.m.b.H. (seit 1. Oktober 1913). Nach 1914 wurde der Verlag von Fritz Meyer (3.1.1876, Magdeburg-24.1.1946, Wien), dem früheren Prokuristen von B.G. Teubner in Leipzig, geführt. Mit diesem Zeitpunkt begann ein Schaffensabschnitt des Verlags, der durch die Veröffentlichung umfassender und typischer kunstgeschichtlicher Werke charakterisiert ist. So widmete sich der Verlag dem österreichischen Denkmälerbestand. In Zusammenarbeit mit Wiener Museen und Instituten verlegte Schroll Kataloge, Einzeldarstellungen und Sammelwerke aus den verschiedensten Gebieten der kunstgeschichtlichen Forschung. Zu nennen wären das Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, der Gesamtkatalog der Albertina, Albertina-Facsimile-Drucke.
Nach dem „Umbruch“ leistete der Verlag Anton Schroll einiges auf literarischem Gebiet, indem er neben kleinen Liebhaberausgaben der Meisterwerke von Brentano, Dickens, Eichendorff usw. auch große Ausgaben der – inzwischen tantiemenfreien – österreichischen Klassiker Grillparzer, Raimund, Nestroy und Anzengruber verlegte. Die Architektur, der Ausgangspunkt der Tätigkeit des Verlags Anton Schroll, trat nie ganz zurück. Zeitgenössische Bestrebungen der Baukunst (s. Adolf Loos) waren durch die Serie Neues Bauen in der Welt weiterhin vertreten.
In den späten 20er Jahren wurden die Verlagsgebiete dadurch erweitert, daß der bis dahin hauptsächlich militärwissenschaftliche Verlag L. W. Seidel & Sohn (gegr. 1848)[6] als Abteilung für historische und wirtschaftsgeographische Literatur ausgebaut wurde.[7] Im Jubiläumskatalog des Verlages Anton Schroll & Co. werden folgende Verlagsgebiete angegeben: Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft/Urgeschichte und Archäologie/Baukunst und Kunstgewerbe/Literatur/Geschichte und Kulturgeschichte/Geographie und Wirtschaftsgeographie/Länder- und Völkerkunde.[8]
c) Verlag Ed. Strache (Verlagshandlung und graphische Kunstanstalt, Warnsdorf i. B./Wien)
Der 1847 in Rumburg (Böhmen) geborene Buch- und Steindruckereibesitzer Eduard Strache trat nach Absolvierung der Gymnasialstudien als Praktikant in eine Buchdruckerei in seinem Geburtsort ein und war längere Zeit dort tätig. Am 1. Dezember 1872 übernahm er den Verlag der Abwehr, einer Zeitung, und gründete im nahen Ort Warnsdorf in Böhmen (Einw. 1918: ca. 23.000), der heute knapp an der Grenze zur DDR liegt, eine eigene Druckerei.
Schon in jungen Jahren war der Betriebsinhaber auf politischem Gebiet, und zwar sowohl als Reichsrats- als auch als Landtagsabgeordneter tätig. Außerdem war Eduard Strache lange Jahre hindurch Bürgermeister von Warnsdorf und auch Bezirksobmann.
Der Verlag Ed. Strache galt als ein Etablissement ersten Ranges dieser Branche und erfreute sich weit über die Grenzen der Monarchie hinaus des größten Ansehens. Neben den Produkten der Graphischen Kunstanstalt verlegte Strache eine Reihe von kleineren Zeitungen (Abwehr, Haider Wochenblatt usw.), Flugschriften und sogar Musikalien.
Als Ed. Strache am 1. Juli 1912 infolge eines Herzleidens starb, wurde das Unternehmen von seinem Sohn Robert (* 7. März 1875 in Warnsdorf) übernommen. Da dieser während des Ersten Weltkriegs zumindest zeitweilig als k.k. Oberleutnant im Wiener Kriegsministerium beschäftigt war, kann das mit ein Grund gewesen sein, daß er sich entschloß, in Wien eine Niederlassung des Warnsdorfer Betriebs als „Ed. Strache Verlag“ zu gründen. Mit Erlaß der k.k. n.-ö. Statthalterei vom 11. Dezember 1917 erhielt Strache die „Konzession zum Betriebe des Buch-, Kunst- und Musikalienverlages, einschließlich dramatischer und musikalischer Bühnenwerke, mit Ausschluß des offenen Ladengeschäfts im Standorte Wien I., Elisabethstraße No. 3 verliehen“.[9]Leiter des Verlags (1915-1918) war der aus Nordböhmen stammende Dr. phil. Johann Pilz (1885-1958).[10] Im Jahre 1918 verlegte der Verlag Ed. Strache seine Haupttätigkeit nach Wien, wo er in erster Linie junge österreichische Belletristik förderte und pflegte. Auf die weitere Entwicklung des Verlags gehen wir an späterer Stelle ein.
d) Wilhelm Braumüller (k. k. Universitäts-Verlagsbuchhandlung, Ges. m. b. H. in Wien)
Die Geschichte der Buchhandlung Braumüller reicht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Ihr Ursprung liegt in der seit 1783 in Wien bestehenden Verlags- und Sortimentsbuchhandlung R. von Mösle“s Witwe, in die am 1. Jänner 1836 Wilhelm Braumüller und L. W. Seidel als Gesellschafter eintraten. Seit 1826 und bis Anfang 1836 war der am 19. März 1807 in Thüringen geborene Wilhelm Braumüller als Gehilfe bei Carl Gerold in Wien angestellt. Am 1. Jänner 1840 ging die Firma Braumüller & Seidel aus dem vorhin erwähnten Witwenfortbetrieb hervor. Am 2. September 1848 schließlich wurde diese Gesellschaftsfirma aufgelöst.
Der Verlag, der bis dahin etwa 150 Werke auf den Markt gebracht hatte, wurde aufgeteilt, und die beiden Verlage Wilhelm Braumüller und L. W. Seidel wurden als Einzelfirmen gegründet. Braumüllers Verlagstätigkeit erstreckte sich nun auf nahezu sämtliche Wissensgebiete, wie z.B. Philosophie, Philologie, Theologie, Geschichte und Volkswirtschaft, Staatswissenschaften, wobei in der Folgezeit besonders das Gebiet der Medizin gepflegt wurde.
Braumüller verstand es um die Mitte des 19. Jahrhunderts, den Verlag mit der medizinischen Schule der Wiener Universität in enge Verbindung zu bringen. Nach dem Tode des Inhabers Wilhelm Braumüller am 25. Juli 1884 übernahm der gleichnamige Sohn die Leitung des Geschäftes, bis auch er fünf Jahre später, am 30. Dezember 1889, starb.
Am 1. Jänner 1894 traten die Enkel des Gründers, Adolf und Rudolf, als öffentliche Gesellschafter ein. Das Geschäft existierte in der erwähnten Form bis zum Jahre 1915. Inzwischen hatte die Verlagsbuchhandlung Braumüller einige große Erfolge zu verzeichnen. Im Jahre 1903 z.B. war es Otto Weiningers Geschlecht und Charakter, das in alle Weltsprachen übersetzt wurde. Großen Erfolg hatte der Verlag auch mit verschiedenen Sprachlehrbüchern, 1918 brachte er die Erstausgabe von Oswald Spenglers berühmt gewordenem Werk Der Untergang des Abendlandes heraus.
Im Jahre 1915 wurde der Verlag von einer Ges.m.b.H. übernommen, an deren Spitze Friedrich Jasper, der Inhaber einer bekannten Wiener Großbuchdruckerei, stand. Der Verlag hieß nunmehr Wilhelm Braumüller Universitäts-Verlagsbuchhandlung, das Sortimentsgeschäft: Wilhelm Braumüller & Sohn Universitäts-Buchhandlung. Die Gleichheit der Namen gab jahrelang Anlaß zur Verwechslung[11], obwohl die beiden Firmen seit Mal 1915 verschiedene Inhaber und nichts mehr gemeinsam hatten. Nach der Übernahme trat der medizinische Verlag immer mehr zurück, und die Geisteswissenschaften sowie aktuelle politische und wirtschaftliche Probleme wurden mehr gepflegt. Der Verlag besteht heute noch in Wien.“[12]
Die Geschichte dieses Verlags reicht bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück. Der am 9. September 1850 in Niederglaucha (Sachsen) geborene Franz Deuticke war im Jahre 1871 nach Wien gekommen, wo er bei Wilhelm Frick angestellt wurde. Sieben Jahre später erwarb Deuticke gemeinsam mit Stanislaus Töplitz die im Jahre 1863 von Karl Czermak gegründete Buchhandlung, die sich schon damals vornehmlich mit dem Vertrieb medizinischer und naturwissenschaftlicher Literatur befaßte. 1886 wurde Deuticke Alleininhaber dieser Firma, der er ein Jahr darauf seinen eigenen Namen gab. Deuticke fügte dem Sortimentsgeschäft einen Verlag und später noch ein Antiquariat hinzu. Alle drei Zweige des Buchhandels nahmen großen Umfang an.
Bis 1919 hatte das Verzeichnis der von ihm verlegten Werke schon 2.500 überschritten. Neben die Medizin mit den ihr benachbarten naturwissenschaftlichen Gebieten trat nun der technische Verlag. Außerdem gab der Verlag Franz Deuticke Lehrbücher für das Hochschulstudium, historische und politische Werke heraus und pflegte einen Schulbücherverlag. Das Unternehmen, das nach dem Tod des Gründers am 2. Juli 1919 von seinen Söhnen übernommen wurde) existiert heute noch als Teil des Bundesverlages in Wien.[13]
Obwohl der Ursprung des Geschäftes auf die im Jahre 1752 dem heute legendären Wiener Buchdrucker Johann Thomas Edler v. Trattner von Kaiserin Maria Theresia verliehenen Buchhandlungsfreiheit zurückgeht, gilt für die Firma Wilhelm Frick der 26. Oktober 1868 als Gründungstag. In diesem Jahr übernahmen die Herren Wilhelm Johann Karl Frick (* 18. November 1843, Güstrow) und Georg Paul Faesy (* 1. August 1843, Zürich) Teile einer aufgelösten Firma und eröffneten am Graben 22 eine Sortimentsbuchhandlung. In den darauffolgenden Jahren war die Buchhandlung auf Werke landwirtschaftlicher Fachliteratur wie fremdsprachiger Literatur spezialisiert. 1881 schied Faesy aus und wandte sich dem Verlag zu. Frick übernahm die Firma und führte sie als Hofbuchhandlung Wilhelm Frick weiter. Nach dem Tod Fricks im Jahre 1886 führte die Witwe den Betrieb weiter. Im Jahre 1908 kam der Sohn Wilhelm Frick an die Spitze des Unternehmens, das nun in seinen Besitz überging und neu organisiert und ausgestattet wurde. Nun entwickelte Frick jun. auch eine rege Verlagstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet der land- und forstwirtschaftlichen Fachliteratur.
In den späten 30er Jahren dieses Jahrhunderts nahm der Verlag Wilhelm Frick (Wien, Leipzig, Olten), der als „katholisch“ galt[14], einen neuen Produktionszweig auf. Ein Prospekt aus dem Jahre 1937 kündigt 12 Neuerscheinungen fär dieses Jahr an. Darunter befinden sich drei Romane sowie ein Bildatlas der Wiener Musikgeschichte. Der Verlagszweig wurde erst in jüngerer Zeit eingestellt. Wilhelm Frick existiert heute noch als Buchhandlung in Wien.[15]
g) Universal-Edition A.G. (Musikalien- und Bühnenverlag)
Obwohl von Anfang an reiner Musikverlag, lohnt es sich, über die Universal-Edition A.G. dennoch ein paar Worte zu verlieren. Sie repräsentiert mit großer Wahrscheinlichkeit die erste reine Verlags-Aktien-Gesellschaft (d.h. im Gegensatz zu bestehenden „Vertikalkonzernen“ mit Papierfabrik, Druckerei, Verlagshandlung, Vertrieb und Sortiment) in Österreich. Mehr noch: Sie ist ein Beispiel dafür, wie man einen etablierten Verlagshäusern in Deutschland ebenbürtigen Verlag in Österreich schaffen konnte, und wichtiger: das Verlegen „moderner“ Musik, vor allem moderner österreichischer Musik, gewissermaßen repatriieren konnte. Die Entwicklung dieser Musik hatte sich bis dahin im wesentlichen außerhalb Österreichs vollzogen. Die musikalischen Verlagshandlungen in Berlin, Leipzig, Mainz und an anderen Orten hatten Österreich den Rang abgelaufen. Selbst die neuen und alten Wiener Klassiker bis zu den Brüdern Strauß fanden in Österreich fast ausschließlich in Leipziger Editionen Verbreitung. Werke von Brahms und Hugo Wolf, um nur zwei Beispiele zu nennen, mußte man in Österreich aus dem Auslande beziehen. Lediglich die „Wiener Operetten“ waren lange Zeit hindurch der einzige nennenswerte Exportartikel Österreichs.
Diese Situation begann sich bedeutend zu verändern, nachdem am 1. Juni 1901 in Wien die konstituierende Generalversammlung der „Universal-Edition A.G.“ abgehalten wurde.[16]Eine Reihe von namhaften Wiener Musikverlegern vereinigte sich mit der – was besonders wichtig war – leistungsfähigen Wiener Notendruckerei R. v. Waldheim, Josef Eberle & Co. in diesem Jahr, um den Grundstein zu einem überaus erfolgreichen Unternehmen zu legen.
Die Anregung, diesen neuen Musikverlag in Wien zu gründen, ging – nach der einen Quelle – vom Bankier Josef Simon, dem Schwager von Johann Strauß[17] nach der anderen von dem etablierten Musikverleger Josef Weinberger aus.[18] Wie dem auch sei: Es fanden sich Wiener Verleger wie Weinberger, Bernhard Herzmansky sen. und Adolf Robitschek im Verwaltungsrat des Unternehmens. Leiter der Universal-Edition war Emil Hertzka (1869-9. 5.1932).
Im Neuen Wiener Tagblatt vom 9. August 1901 konnte man zur Gründung folgendes lesen:
Ein großes musikalisches Verlagsunternehmen ist in Wien soeben ins Leben gerufen worden, wie es in dieser Art und in solchem Umfange in Österreich noch nicht bestanden hat. Die neue Musikausgabe, welche unter Zusammenwirken der hervorragendsten Interessenten des österreichisch-ungarischen Musikverlags gegründet wurden, führt den Titel “Universal-Edition“. Die “Universal-Edition“ ist eine musikalische Collektivausgabe, welche sowohl die Werke der Classiker wie auch die hervorragendsten Werke instruktiver Art umfassen wird, denen sich Schöpfungen bedeutender moderner Meister anreihen werden. (…)
Die Universal-Edition wurde bald zum „Stolz Österreichs“ und konnte sich neben die bislang unentbehrlich gewesene „Edition Peters“ in Leipzig und die Reclamsche „Universal-Bibliothek“ in eine Reihe stellen. Somit war praktisch die gesamte Tonkunst – die Klassiker, die Romantiker, ein großer Teil der Modernen, alle Studienwerke und auch die gangbaren Unterhaltungsstücke, für jedes Instrument und jede Stimmlage nicht in Leipzig, sondern in Wien erhältlich. Innerhalb der ersten zehn Jahre erreichte die Verlagsproduktion 5.000 Nummern. (Ein einigermaßen vergleichbarer Versuch, die Wiener Moderne in der Literatur zu repatriieren, war der „Wiener Verlag“, von dem später die Rede sein wird.)
Trotz Jubiläums und großer Ausstellung in Wien im Jahre 1976 bleibt die Geschichte der Universal-Edition auf vielen Strecken noch ungeschrieben. Freilich verträgt sich so manches, was im Bereich der U.E. nach dem März 1938 passierte und was im Katalog 1976 schamhaft verschwiegen wird, nicht unbedingt mit dem Firmenimage.[19]
h) Styria (Meyerhoff/Moser, Universitätsbuchdruckerei, Verlagsbuchhandlung in Graz)
Der „Styria“ Verlag hat seinen Ursprung in der Gründung des „Katholischen Preßvereins in der Diözese Seckau“ in Graz am 16. September 1869. Am 1. Jänner des folgenden Jahres erfolgt die Eröffnung der „Vereinsdruckerei“, am 1. März die einer Verlagsbuchhandlung.[20] Die ersten Verlagswerke erschienen nun im Verlag der „Vereinsdruckerei“. Im Jahre 1879 nannte sich die Vereinsdruckerei nunmehr „Druckerei Styria“. Im Jahre darauf kam eine Sortimentsbuchhandlung hinzu. 1886 durfte sich die Hauptdruckerei „Styria“ nun k.k. Universitätsbuchdruckerei nennen. 1887 wurde das Unternehmen durch Ankauf der Buchdruckerei und Geschäftsbücherfabrik „Gutenberg“ vergrößert. Sechs Jahre später erfolgte der Erwerb der Stifterschen Buchdruckerei und Buchhandlung in Judenburg.
Nach 34 Jahren, im Jahre 1904, war der Verlagskatalog bereits 74 Seiten stark. Der Verlag verlegte hauptsächlich theologische, volkstümliche, belletristische, geschichtliche Literatur und Kirchenmusik. Zum Verlagsbetrieb zählte auch der Zeitungsverlag (Grazer Volksblatt [seit 1871], Kleine Zeitung [seit 1904], Sonntagsbote)[21] Im Jahr 1918 ging die Buchhandlung Ulrich Moser (Meyerhoff in Graz in den Besitz des Katholischen Preßvereins über und mit 1. Jänner 1922 die Verlagsbuchhandlung und Druckerei A. Pustet in Salzburg (gegr. 1865) in den Besitz der Universitäts-Buchdrucker und Verlagsbuchhandlung „Styria“ in Graz. „Styria“ besteht heute noch als Druck- und Verlagshaus (Wien – Graz – Köln).
Moser/Meyerhoff
Die Hofbuchhandlung Ulrich Moser in Graz wurde am 2. April 1868 durch den aus Steinbach in Württemberg gebürtigen Buchhändler Ulrich Moser gegründet. Vorerst beschäftigte sich die Firma fast ausschließlich mit Sortiment, doch wurde bald darauf ein Verlag katholischer Literatur entwickelt. Nach dem Tode des Gründers wurde die Firma von dem am 28. August 1854 in Hamm/Westfalen geborenen Buchhändler Julius Meyerhoff am 1. Jänner 1882 gekauft. Nun wurden die Verlagsgeschäfte ausgedehnt und besonders Theologie, Geschichte und Heimatgeschichte, Rechtswissenschaft und vaterländische Jugendschriften gepflegt. Meyerhoff, der nun einen in der ganzen Monarchie anerkannten und führenden österreichischen Verlag betrieb, wurde im Jahr 1907 der Titel eines Hofbuchhändlers verliehen. Am 1. April 1918 verkaufte er die Buchhandlung an Styria (s.o.).[22] Meyerhoff starb drei Jahre später am 21. April 1921.
Die Manz’sche Buchhandlung wurde im Jahre 1843 von Christian Jasper (1780-1846), einem aus Norddeutschland stammenden, in Leipzig ausgebildeten Buchhändler gemeinsam mit seinem Neffen Friedrich Jasper (1805-1849) als „Jaspersche Buchhandlung“ gegründet. Die Firma pflegte das Sortiment und entwickelte eine rege Verlagstätigkeit. Drei Jahre später starb Christian Jasper, worauf das Geschäft auf seinen Neffen überging. Dieser nahm wiederum seine beiden Gehilfen Eduard Hügel (29.7.1816, Raab-13.12.1887, Wien) und Friedrich Manz als Gesellschafter auf. Der Firmenname lautete nunmehr: „Jasper, Hügel und Manz“. Als auch dann Friedrich Jasper im Jahre 1849 starb und das Geschäft an seine Gesellschafter überging, wurde das Unternehmen aufgeteilt: Eduard Hügel übernahm den Buchladen, und Friedrich Manz übernahm den Verlag und übersiedelte auf den Kohlmarkt, wo sich das Geschäft heute noch befindet. Unter seiner Führung gewann es seinen Ruf als juristische Spezialbuchhandlung und juristischer Verlag. Der nunmehrige Alleininhaber Friedrich Manz starb 1866 und hinterließ die Verlagsbuchhandlung seinem Bruder, dem Regensburger Verleger J.G. Manz. Dessen Sohn Hermann (* 6.5.1839), ebenfalls Buchhändler, kam vier Jahre später im Jahre 1870 nach Wien, um hier als Teilhaber seines Vaters das Wiener Geschäft zu übernehmen. Hermann Manz bemühte sich, das Werk seines Onkels fortzusetzen, aber sein Wunsch war es, in Wien eine Kunsthandlung zu errichten. Mit 1. Jänner 1883 verkaufte er das Geschäft am Kohlmarkt an den Schulbuchverlag Julius Klinkhardt in Leipzig, dessen Wiener Gesellschafter Markus Stein von nun ab seine Leitung übernahm. Am 1. Jänner 1898 kam Dr. Richard Stein als zweiter Gesellschafter hinzu. Die Generationenfolge bei Manz verhält sich also folgendermaßen: Julius Klinkhardt in Leipzig war der Ururgroßvater, Markus Stein der Urgroßvater, Dr. Richard Stein der Großvater, Dr. Robert Stein (30.6.1899-Juli 1980) der Vater des heutigen Inhabers der Firma Manz, Franz Stein.
Mittlerweile stieg der letzte Manz, Hermann, nach einem kurzen Zwischenspiel in seiner Geburtsstadt Regensburg wieder in Wien in das Verlagsgeschäft ein. Am 1. Oktober 1885 ging die Buchhandelsfirma Gerold & Co. in den Besitz von Friedrich Gerold jun. (* 1842) und Hermann Manz über. Im Jahre 1895 wurde Manz ihr Alleininhaber. Der geschäftliche Erfolg stellte sich nicht ein, und Manz wählte den Freitod am 14. Oktober 1896.
Die Manz’sche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung (Julius Klinkhardt & Co.), die eine eigene Buchdruckerei hatte, trat vor allem als Zeitschriftenverleger und Herausgeber von Gesetzeswerken hervor. Zu den vielen juristischen Fachzeitschriften zählten:Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung, Gazetta del Tribunali, Juristische Vierteljahrsschrift, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht u.v.a. Wie andere Verlage auch, von denen ein Gutteil der Produktion die Existenz der Monarchie, den Zusammenhang der beiden Reichshälften zur Voraussetzung hatte, war der juristische Fachverlag Manz vom „Umbruch“ unmittelbar betroffen. Das Erscheinen neuer Gesetze nach Ende des Ersten Weltkriegs z.B. bedeutete den Verlust von Lagerbeständen. Die Firma gehörte aber zu denen, die rasch die Konsequenzen aus der veränderten Lage zogen. Man nützte die (relative) Billigkeit der Erzeugung in Österreich im Verhältnis zum Stande der Valutenkurse und schuf innerhalb kürzester Zeit die „Collection Manz“. Diese war eine aus vier Serien bestehende Neuausgabe französischer Originalwerke. Ihre Vorzüge laut Verlagswerbung:
Sorgfältig erlesene Auswahl für alle Gebildeten des In- und Auslandes. Ungekürzte, literarisch sorgfältig geprüfte Texte beliebtester Autoren. Gediegene, einheitliche geschlossene Ausstattung: Schöner, leicht lesbarer Druck. Gutes Papier. Handliches Format. Den heimischen Verhältnissen und dem Bedürfnis des Gebildeten angepaßte erschwingl. Ladenpreise!
Schnelle, spielend leichte Beschaffung. Vollwertiger Ersatz für die bis fast zur Unmöglichkeit erschwerten Auslandsbezüge bei guter Rabattierung und unter Vermeidung der durch die Valuta ins Ungemessene gewachsenen Auslandsspesen.[23]
Auf die „Collection Manz“ folgte eine weitere Sammlung, unter dem Namen „Editions Larousse“, die Werke zeitgenössischer französischer Schriftsteller enthalten sollte. Aus Copyrightgründen war der Verkauf nach Frankreich, Belgien und den französischen Kolonien nicht gestattet.
 Fast gleichzeitig mit dem Erscheinen der „Collection Manz“ wurde ein mit großem Kapital finanzierter neuer Verlag in Wien gegründet. Er hieß Rhombus-Verlag, begann als Ges.m.b.H. am 23. März 1920 und wurde ab 1. Jänner 1921 als Aktien-Gesellschaft geführt, deren Papiere als Exoten an der Wiener Börse gehandelt wurden. Wie in diesem konkreten Fall Manz nützte auch der Rhombus-Verlag die damaligen Valutaverhältnisse und die damit gegenüber dem Ausland billigere Herstellung vorwiegend im Ausland gangbarer Artikel. Der Unterschied zu Manz: Es wurden auch Ausgaben in englischer Originalsprache produziert .[24]
Fast gleichzeitig mit dem Erscheinen der „Collection Manz“ wurde ein mit großem Kapital finanzierter neuer Verlag in Wien gegründet. Er hieß Rhombus-Verlag, begann als Ges.m.b.H. am 23. März 1920 und wurde ab 1. Jänner 1921 als Aktien-Gesellschaft geführt, deren Papiere als Exoten an der Wiener Börse gehandelt wurden. Wie in diesem konkreten Fall Manz nützte auch der Rhombus-Verlag die damaligen Valutaverhältnisse und die damit gegenüber dem Ausland billigere Herstellung vorwiegend im Ausland gangbarer Artikel. Der Unterschied zu Manz: Es wurden auch Ausgaben in englischer Originalsprache produziert .[24]
Die weit über die Grenzen der Monarchie hinaus bekannte Verlagsbuchhandlung Ed. Hölzel wurde am 15. Oktober 1844 in Olmütz gegründet. Die Aufmerksamkeit des Gründers Eduard Hölzel galt ursprünglich den Bedürfnissen der Schule. Um Mißständen im geographischen Unterricht in den Schulen zu begegnen, pflegte Hölzel von Anfang an den kartographischen Verlag. Hölzel produzierte eine große Anzahl von Schulatlanten für alle Disziplinen und Unterrichtsstufen und in den Sprachen aller Nationen, die die ehemalige österr.-ungarische Monarchie umfaßte. Ein weiterer Schwerpunkt der Verlagsproduktion war das ethnographische Gebiet.
Neben der Verlagsbuchhandlung wurde am 25. Jänner 1861 die Firma Ed. Hölzel Geographisches Institut und Lithographie-Anstalt gegründet. Diese Anstalt produzierte geographische Kartenwerke und übernahm in der verlagseigenen chromolithographischen Kunstanstalt und Steindruckerei Aufträge zur Ausführung von chromolithographischen sowie kartographischen Arbeiten jeder Art (Plakate, Reklamewerke, Kalender usw.).
Als die Firma 1919 ihr 75jähriges Jubiläum feierte, war sie im Besitz einer K.G. Öffentliche Gesellschafter waren Otto Schweitzer (Chef) und Vinzenz Eisenmeier.
Nach Ausrufung der Republik machte die Firma Ed. Hölzel eine bemerkenswerte Entwicklung durch. In Zusammenarbeit mit dem Archiv der staatlichen Lichtbildstelle (BKA) wurde eine Zweiganstalt unter der Firma „Österreichische Verlagsgesellschaft Ed. Hölzel & Co. Ges.m.b.H.“ gegründet, die es sich zur Aufgabe machte, die Kunstschätze Österreichs in ganz besonderer Weise verlegerisch zu verwerten.[25]
Wie ein Großteil der in Österreich im 19. Jahrhundert gegründeten Verlagsunternehmen wurde auch die Firma „Urban & Schwarzenberg“ von einem „Zugereisten“ ins Leben gerufen. Seniorchef war der am 4. Oktober 1838 zu Königswalde in der Mark Brandenburg geborene Ernst Urban. Zweiter Gründer des zu Weltruf gelangten medizinischen und naturwissenschaftlichen Verlages war der am 26. November 1838 geborene Sohn eines Arztes aus Bielitz, Ernst Schwarzenberg. Am 1. Dezember 1866 wurden Ernst Urban und Ernst Schwarzenberg die Konzession zum Betriebe des Buchhandels in der Inneren Stadt in Wien erteilt. Ihre Geschäftstätigkeit begann mit dem Vertrieb zweier deutscher Zeitungen (einer Modenzeitschrift und einer Unterhaltungszeitschrift) in Wien. Darauf verlegte sich die junge Firma hauptsächlich auf den Reisevertrieb und trat mit dem Bibliographischen Institut in Leipzig in enge Fühlung. Die eigentliche spezifische Tätigkeit der Firma, durch die sie in der Folge berühmt wurde, begann aber durch den Verlag der Wiener Medizinischen Presse. Diese war bis dahin im Selbstverlag des Herausgebers, des Vaters Arthur Schnitzlers, Prof. J. Schnitzler, erschienen. 1875 folgte die Wiener Klinik, ab 1878 die Real-Enzyklopädie der gesamten Heilkunde. Allgemein wurde die ganz hervorragende buchtechnische Qualität der Werke aus dem Verlag Urban & Schwarzenberg gelobt. Im Laufe der Jahre pflegte man nicht nur die medizinische Wissenschaft. Auch das Gebiet der Technik (Enzyklopädie des Eisenbahnwesens) und der technischen Chemie wurde berücksichtigt.
Am 1. Juli 1898 wurde eine Berliner Zweigniederlassung gegründet, die von Eduard, einem der drei Söhne Ernst Urbans, geleitet wurde. Sein Zwillingsbruder Karl (* 1. 12.1866) blieb in Wien zur persönlichen Unterstützung seines Vaters. Am 5. Juni 1905 schieden Eugen Schwarzenberg und Karl Urban nach einer fast 40jährigen Tätigkeit aus der Firma aus. Schwarzenberg starb 1908.
Heute ist die Firma Urban & Schwarzenberg in München ansässig und betreibt eine Zweigniederlassung (Buchhandlung) in Wien.[26]
l) Verlag der Wiener Volksbuchhandlung[27]
Die Eröffnung der „Ersten Wiener Volksbuchhandlung, Ignaz Brand“ wurde am 26. Jänner 1894 in der Arbeiter-Zeitung (S. 12) angekündigt. Der Inhaber der neuen Firma, der am 28. April 1844 in Znaim geborene Ignaz Brand, war, als er sich 1893 um eine Konzession bewarb, Buchhalter bei der Firma Gerold & Co. in Wien.
Im Gründungsjahr hatte Brand einen Buchhandlungsgehilfen namens Hugo Heller aus Stuttgart nach Wien geholt. Heller (1871-1923, Wien), der 1902 aus der Wiener Firma wieder ausschied, gründete im September 1905 seine eigene Buch- und Kunsthandlung in Wien und wurde eine der rührigsten Persönlichkeiten im Wiener Kulturleben.[28] Er blieb weiterhin der Wiener Volksbildung verbunden.
Bereits im ersten Jahr der „Wiener Volksbuchhandlung“ begann neben dem Sortimentsgeschäft, das sich besonders an Parteigenossen der Sozialdemokratischen Partei wendete, eine bescheidene Verlagstätigkeit. Im Jahre 1896 konnte die Volksbuchhandlung bereits als Verlag einiger Publikationen wie z. B der Neuen Glühlichter, des Österreichischer Arbeiter-Kalenders, des Eisenbahner-Kalenders usw. firmieren. Im März 1908 erfolgte die Protokollierung der „Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand & Co.“ beim Wiener Handelsgericht. Nun war die Buchhandlung im Eigentum der Sozialdemokratischen Partei. Ende 1909 wies die Verlagsproduktion 192 Titel auf. Hierunter befanden sich Sozialpolitische Flugschriften, Wiener Arbeiterbibliothek, Lichtstrahlen, Volksschriften aber Gesundheitswesen und Sozialpolitik, Marx-Studien usw. Ende 1913 wurde die Zahl von 289 Titeln erreicht. Im Laufe des folgenden Jahres übernahm Dr. Robert Danneberg die Leitung der Volksbuchhandlung. Der Begründer Ignaz Brand beging am 13. Mai 1916 Selbstmord.
Die Verlagstätigkeit, die keine Belletristik miteinschloß, ging während der Kriegsjahre zurück, um dann 1919 einen „bedeutenden Aufschwung“ zu nehmen. Neue Zeitschriften und Publikationen kamen hinzu (z.B. „Bildungsarbeit“, „Sozialistische Bücherei“).
1929 wurde die Volksbuchhandlung die Zentraleinkaufsgesellschaft für die österreichischen Arbeiterbüchereien. Bis Ende 1932 erreichte die Verlagsproduktion 668 Titel. Die letzte Publikation, die vor Februar 1934 erscheinen konnte, war die Nummer 689. Nach dem Februar wurde die Volksbuchhandlung gesperrt.
m) Moritz Perles [29] (Verlags-, Sortiments- und Kommissions-Buchhandlung)
Eine der heute völlig vergessenen, überragenden Persönlichkeiten im Verlags- und Buchhandel im Österreich des 19. und frühen 20. Jahrhunderts war Moritz Perles. Am 15. Dezember 1844 in Prag geboren, trat er in jungen Jahren in Prag in die Lehre und nach Absolvierung seiner Gehilfenzeit in Mannheim und Wien (Beck’sche Universitäts-Buchhandlung) machte er sich selbständig und gründete nach erheblichen Schwierigkeiten (wegen „Überfüllung Wiens mit derlei Gewerben“) hinsichtlich einer Konzession am 15. März 1869 seine eigene Firma. Aber schon als Gehilfe gründete er im Jahre 1865 das Adreßbuch für den Buch-, Kunst- und Musikalienhandel der österreichisch-ungarischen Monarchie. Es erschien jährlich bis Band 52, 1918 und wurde von ihm persönlich bis einschließlich 1917 herausgegeben.[30]
Aus der kleinen Buchhandlung in der Steindlgasse im 1. Bezirk wuchs ein nicht nur für österreichisch-ungarische Verhältnisse riesiges Buchhandels- und Verlagsunternehmen. Die Firma Moritz Perles vereinigte nämlich Verlag, Sortiment und Kommissionsgeschäft. Bereits im Gründungsjahr wurde ein Kalenderverlag errichtet (erster Kalender: Juristen-Kalender für 1870) und eine Zeitschrift übernommen.
Im folgenden Jahr erfolgte die Errichtung eines Kriegskartenverlags und einer Zweigniederlassung in Leipzig. Nach der Jahrhundertwende bezeichnete sich die Firma auf Geschäftspapier gar als „Größten österreichischen Kalender-Verlag“. Der Verlag von Moritz Perles basierte nämlich auf der Grundidee der stabilen, immerwiederkehrenden Jahreserscheinungen, der Zeitschriften und der Kalender, und diesem Grundsatz blieb er auch bis zum „Raub“ 1938 treu. Zu diesem Zweck schuf die Firma zum allergrößten Teil ganz neu begründete, hochangesehene Wochenblätter, Monatsschriften und Jahrbücher. So wurden etwa 1878 der Jagdkalender und ein einschlägiger Verlag gegründet. Die Spezialitäten des Buchverlags waren – Jurisprudenz, Medizin, Veterinärkunde, Land- und Forstwirtschaft sowie künstlerische und geographische Prachtwerke. Ab 1881 erschienen z. B. die Österreichischen Justizgesetze, ab 1883 das Österreichische Centralblatt für juristische Praxis, Centralblatt für die gesammte Theorie usw.
1888 erwarb Perles die in Fachkreisen sehr bedeutende Wiener Medizinische Wochenschrift, die bis 1938, als sie dem Raub der heimischen Arisierungsgeier zum Opfer fiel, bei ihm erscheinen konnte.
Im Jahre 1918 erschienen im Verlag Moritz Perles nicht weniger als 19 Zeitschriften. Dazu kommt noch die große Zahl von Zeitschriften, für die Perles die Alleinvertretung in Österreich-Ungarn hatte. Im Buchverlag erschienen auch noch die mehrbändige Encyclopädie für Forst- und Jagdwissenschaften und die Encyclopädie für Thierbeilkunde.
Ein gleichermaßen wichtiger Zweig der Firma Moritz Perles war das Kommissionsgeschäft. Sie hielt ein großes Auslieferungslager reichsdeutscher und ausländischer Verleger für die österreichisch-ungarische Monarchie und vertrat immerhin 20 Verlage (1918) bzw. über 40 Verlage und Firmen (1934).
Das Sortimentsgeschäft, d.h. die Buchhandlung, die 1889 in ein eigenes Geschäftshaus in der Seilergasse 4 im 1. Bezirk übersiedelte, gehörte zu den vielseitigsten, größten und zugleich angesehensten am Wiener Platz. Obwohl Perles keine schöngeistigen Werke herausbrachte – höchstens als Kommissionsverlag – bedeutet dies nicht, daß die Firma kein Förderer der Literatur war. Das Geschäft in der Seilergasse spielte eine nicht unbedeutende Rolle in literarischen und wissenschaftlichen Kreisen Wiens. Besonders beliebt waren Perles‘ Weihnachtskataloge, die für Kunden aufgelegt wurden. So erschien in dieser Form 1907 die erste Folge der Köpfe aus dem literarischen Wien, gezeichnet vom Maler H. Rauchinger. Nach dem Kriege begann der Literarische Almanach zu erscheinen, der etwa 1924 von der Publikation Wiener literarische Signale (bis 1937) abgelöst wurde. Der Hauptinhalt neben Bücherverzeichnissen: Selbstanzeigen von Neuerscheinungen österreichischer und deutscher Schriftsteller.[31]
Als der Seniorchef der Firma, Moritz Perles, am 25. Februar 1917 starb, ging das Unternehmen an die zwei Söhne, Dr. Ernst Perles (17.7.1876, Wien) und Oskar Perles (* 16.4.1875, Wien), sowie an den langjährigen Gesellschafter Friedrich Schiller (* 1854, Prag) über. Nach dem Ausscheiden des Letztem in der ersten Hälfte der 30er Jahre führten die Brüder Perles, die nun je einen 50%igen Anteil hatten, das Geschäft allein weiter.
Mit dem März 1938 kam es zu einer sukzessiven Demontage der einstigen Großfirma, denn Perles war eine ansehnliche „Beute“. Da waren zum einen die wertvollen Liegenschaften (wie 1., Seilergasse 4), die im Familienbesitz waren, zum anderen die Verlagsrechte, das beträchtliche Warenlager und die vielen Zeitschriften.
So mußten die zwei Brüder als Firmeninhaber auf Grund eines Beschlusses der Reichsschrifttumskammer in Berlin ihre buchhändlerische Tätigkeit mit 30. September 1938 einstellen. Obwohl sie de jure weiterhin Inhaber waren, dürften sie nicht mehr viel Einfluß auf die Gebarung der Firma gehabt haben. So teilte die Vermögensverkehrsstelle der Prüfstelle für kommissarische Verwaltung am 25. August 1938 mit, daß laut Mitteilung der RSK, Wiener Büro, Dr. Karl Zartmann, „derart verworrene Verhältnisse“ im Verlag die Bestellung eines kommissarischen Verwalters „unerläßlich“ machten.[32] Ab 15. September bekleidete der Buchhändler Arthur Pribyslavsky, der zu den Arisierungskandidaten im Rennen um die Firma Perles zählte, diese Funktion. Am 10. Februar 1939 kam es zur Bestellung von Dr. Gottfried Linsmayer als Abwickler.
Das Rennen machten jedoch andere Leute und Firmen, deren Leiter entweder seit Anfang der 30er Jahre (illegale) NSDAP-Mitglieder, SA- oder SS-Mitglieder waren, solche im allerengsten Familienkreis hatten und sich damit brüsten konnten oder die nachweislich die Bewegung in der illegalen Zeit unterstützt hatten. So auch im Fall Perles. Einige Fachkalender wanderten z. B. an die Firma Carl Fromme, deren Inhaber seit 1. März 1932 Mitglied der NSDAP war (No. 897.231), der Zellenleiter war und einer „politischen Gliederung“ der NSDAP angehörte. Eine ähnliche Karriere hatten andere hinter und damit eine große Karriere vor sich. Den größten Anteil bekam der am 31.5.1900 in Wien geborene Johannes Katzler, der wenige Tage nach dem „Anschluß“ aus dem „Altreich“ in seine Heimatstadt zurückkehrte und innerhalb kürzester Zeit zum größten Ariseur im österreichischen Buchhandel wurde. Allein auf sein Konto gehen sieben (7) Arisierungen.[33] Von Moritz Perles übernahm er „lediglich“ das Warenlager – mit der Auflage, es in den 4. Bezirk zur transportieren – und die Verlagsrechte, alles in allen, also kein geringer Wert. Nur: bezahlt wurde nichts, und erst recht nicht an die „rechtmäßigen“ Inhaber. Dazu der Vermerk im betreffenden Akt: „Ein Gegenwert für diese Übertragung wurde weder errechnet noch an Katzler vorgeschrieben.“[34]
Ein weiterer Gewinner der Firmendemontage war die Gesellschaftsbuchdruckerei Brüder Hollinek. Das Objekt: die bedeutende Wiener Medizinische Wochenschrift, die seit 1888 bei Perles erschienen war. Bezahlt wurde hiefür aber nichts. Das heißt, Hollinek konnte über einen Rechtsanwalt glaubhaft machen, die Übernahme decke die Perles-Schulden.[35]
An die Firma Moritz Perles erinnert in Wien heute nichts mehr. Längst verschwunden sind die Geschäftsauslagen, die im Jahre 1926 vom Architekten Ernst Lichtblau entworfen wurden, und das Geschäfts-„Markenzeichen“ in der Seilergasse – der überdimensionierte „Bücherwurm“, der von dem Graphiker Julius Klinger, der auch mehrere Verlagssignets entwarf, konzipiert wurde.[36]
n) Gerlach & Wiedling [37] (Buch- und Kunstverlag)
 Am 1. April 1872 wurde von dem erst 26jährigen Martin Gerlach[38] in Berlin eine Verlagsbuchhandlung gegründet, mit der er auch die Auslieferung der kunstgewerblichen Zeitschrift Die Perle, die zugleich das Erstlingswerk darstellte, verband. Den Weg zu seiner Verlagstätigkeit hatte Gerlach, der ursprünglich selbst Zeichner, Graveur und Ziseleur war, von der Goldschmiedekunst aus genommen.
Am 1. April 1872 wurde von dem erst 26jährigen Martin Gerlach[38] in Berlin eine Verlagsbuchhandlung gegründet, mit der er auch die Auslieferung der kunstgewerblichen Zeitschrift Die Perle, die zugleich das Erstlingswerk darstellte, verband. Den Weg zu seiner Verlagstätigkeit hatte Gerlach, der ursprünglich selbst Zeichner, Graveur und Ziseleur war, von der Goldschmiedekunst aus genommen.
Im Jahre 1873 verlegte Gerlach den Sitz von seinem anfänglich kleinen Verlag kunstgewerblicher Richtung nach Wien, wo er unter der Firma „Martin Gerlach & Co.“ in Vereinigung mit Ferdinand Schenk[39] eine Reihe größerer Verlagsartikel herausgab.
Einige Jahre danach wurde die Firma in „Gerlach & Schenk“ umbenannt. Im Mai 1882 kam der 23 Jahre alte Albert Wiedling[40] nach Wien, um zunächst als Gehilfe, später (1895) als Prokurist in der Firma „Gerlach & Schenk“ tätig zu sein. Als im Oktober 1901 der Mitbesitzer Schenk aus der Firma ausschied, um eine neue Firma, die seinen Namen trug („Ferd. Schenk, Verlag für Kunst und Gewerbe“), zu gründen, wurde Albert Wiedling Teilnehmer der Firma „Martin Gerlach & Co.“, die dann 1904 in „Gerlach & Wiedling“ geändert wurde.
Die Firma „Gerlach & Schenk“ hatte sich im In- und Ausland sehr rasch vor allem wegen der technisch außergewöhnlichen Ausstattung ihrer Bücher einen Namen gemacht. Erinnert sei an folgende Werke:[41] Allegorien und Embleme, Die Pflanze und das Tier in Kunst und Gewerbe, das Sammelwerk Die Quelle, Festons und Dekorative Gruppen, Gewerbe-Monogramme, Volksschmuck. Es gelang Gerlach, der vom Kunstschriftsteller Joseph August Lux ein „Führer der Modernen“ genannt wird[42], wertvolle junge Talente aufzuspüren und fast sämtliche namhaften Künstler für seine Firma zu gewinnen. Das waren u. a. Czeschka, K. Moser, Schmutzer, Unger, beide Klimt, Lefler u.a. wie auch ausländische Maler wie Stuck und Klinger.
Nach der Jahrhundertwende wurde die Verlagstätigkeit auf neue Gebiete ausgedehnt. So begann das Haus 1901 auch eine Serie reizvoll ausgestatteter Kinderbücher herauszugeben. Zweck von Gerlachs Jugendbücherei war es, der Jugend wahrhaft volkstümliche Kunst zu vermitteln.[43] Doch setzten diese Bücher zugleich ein höheres künstlerisches Verständnis voraus und wendeten sich zu einem sehr vernünftigen Preis – nur an exklusive Kreise. Zwischen 1901 (Band 1: Kinder- und Hausmärchen nach der Sammlung der Brüder Grimm) und 1920 erschienen 34 Nummern.
Wohl durch die neuentstandene Verbindung mit der Gemeinde Wien – Gerlach & Wiedling wurde deren Kommissions-Verlag – publizierte der Verlag Werke zum Thema Wien (z. B.: Wien und Umgebung, Wiener Lieder und Tänze). Auf literarischem Gebiet produzierte Gerlach & Wiedling später den Volksschatz und Meisterwerke der Prosa. Mit Unterstützung der Gemeinde Wien wurde außerdem die große kritische Grillparzer-Ausgabe herausgebracht.
Nach dem Tod von Verlagsgründer Martin Gerlach im Jahre 1918[44] und dem Tod von Albert Wiedling 1923[45]traten an deren Stelle die Söhne Franz Gerlach[46] und Walter Wiedling[47]. Sie führten die Firma nach Tradition des Hauses weiter. In der Person Walter Wiedlings als Geschäftsführer bestand seit der Gründung des Deutschen Verlags für Jugend und Volk im Jahre 1921 eine Union.
Der Verlag wurde nach dem Zweiten Weltkrieg trotz erheblicher Kriegsschäden und der wirtschaftlichen Hemmungen wieder aufgenommen, und die Produktion lief seit Ende 1945, um zwischen 1952 und 1955 sistiert zu werden.
1947 feierte der Verlag sein 75. Jubiläum mit einer kleinen Festschrift.[48] Das Jubiläum des 100jährigen Bestandes – zumindest des Namens – erlebte der Verlag nur sehr knapp. Im Jahre 1972 war die Firma von Hermann Waldbaur (* 7.8.1897) übernommen worden, doch erfolgte die Gewerberücklegung bereits im Jahre 1976.[49]
o) Carl Fromme (k. k. Hofbuchdruckerei und Hofverlagsbuchhandlung)[50]
 Als Gründungsjahr dieses Unternehmens gilt allgemein das Jahr 1751. Denn als Begründer dieses wohl ältesten österreichischen Verlags ist der legendäre Johann Thomas Edler von Trattner, der als „Vater des österreichischen Buchhandels“ apostrophiert wird, anzusehen.[51] Trattner erhielt 1752 von der Kaiserin Maria Theresia als erster das Privileg eines „Hofbuchhändlers“. Im Jahre 1805 ging die Buchhandlung am Graben im Trattnerhof an Joseph Tendler durch Verkauf von Trattners Enkel über.
Als Gründungsjahr dieses Unternehmens gilt allgemein das Jahr 1751. Denn als Begründer dieses wohl ältesten österreichischen Verlags ist der legendäre Johann Thomas Edler von Trattner, der als „Vater des österreichischen Buchhandels“ apostrophiert wird, anzusehen.[51] Trattner erhielt 1752 von der Kaiserin Maria Theresia als erster das Privileg eines „Hofbuchhändlers“. Im Jahre 1805 ging die Buchhandlung am Graben im Trattnerhof an Joseph Tendler durch Verkauf von Trattners Enkel über.
Der aus Harburg a. d. Elbe in Deutschland gebürtige Carl (Ludwig Franz Wilhelm) kam 1851 nach Brünn und im folgenden Jahr nach Wien, um dort zusammen mit Sylvester Pötzelberger die Buchhandlung am Graben zu übernehmen. Er führte sie unter der Firma Tendler & Comp. (Pötzelberger & Fromme) weiter. 1862 wurde Fromme alleiniger Besitzer der Firma. Fünf Jahre später verkaufte er das Sortiment und erwarb dafür die Keck & Pietersche Buchdruckerei, und von nun an lautete der Firmenname: Carl Fromme Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung.
Fromme gilt allgemein als der Gründer des österreichischen Kalenderverlags.[52] Begonnen hat das Unternehmen 1855, als der Medizinal-Kalender in Verlag genommen wurde und 1867, als Fromme den eigentlichen Verlag gründete.
Nach dem Tode Frommes im Jahre 1884 in Wien ging das Geschäft an dessen Erben über. Im selben Jahr kam ein Neffe Carl Frommes, Carl Georg Christian Fromme, nach Wien, um in leitender Stellung tätig zu sein. Am 1. Jänner 1889 wurde der Neffe des Gründers als Gesellschafter in die Firma aufgenommen. Erst 1896 schieden die Erben nach Fromme bis auf Otto Fromme,[53] den jüngsten Sohn Carl Frommes, aus der Firma aus, die nunmehr in den Besitz von Carl und Otto Fromme überging.
Während Carl als k. u. k. Hofbuchdrucker die Leitung der Buchdruckerei übernahm, leitete Otto, der k. u. k. Hof-Verlagsbuchhändler, die Verlagsbuchhandlung. Bis etwa 1891 widmete sich die Firma ausschließlich dem Kalenderverlag, der auch weiterhin den Grundpfeiler des Verlags bildete, und dann wurde der meist landwirtschaftliche und technische Verlag von G. P. Faesy in Wien erworben. Nebenbei pflegte man wissenschaftliche und fachwissenschaftliche Literatur. Im neuen Jahrhundert wurde die Verlagstätigkeit durch Übernahme von Werken aus den Gebieten der Forstwirtschaft, Technik, Pharmazie sowie Schulbücher erweitert. Erst Mitte der 30er Jahre entschloß man sich, das Verlagsprogramm zu erweitern, um den Verlag zu einer Pflegestätte der österreichischen Literatur zu gestalten.[54] Aber auch das ab 1897 bei Fromme in Lieferungen erscheinende Standardwerk von Nagl-Zeidler-Castle, die Deutsch-Österreichische-Literaturgeschichte, die schließlich mit dem 4. Band 1937 abgeschlossen wurde, trug zum Renommee der Firma bei.
Aber der Name Fromme war – obwohl er bald Konkurrenten bekam – mit Kalendern eng verbunden. Vor allem die topographische Ausstattung übte eine besondere Anziehungskraft aus. Die Firma Fromme war eine der ersten, die moderne zeitgenössische Künstler für die Gestaltung einzelner Kalender zur Mitarbeit heranzog (z.B. Kolo Moser).[55] Für fast jeden Stand und Beruf gab es speziell geschaffene Kalender. Zu erwähnen wären Fromme’s Klerus-, Feuerwehr-, Forst-, Garten-, Juristen-, Landmann-, Landwehr-, Landwirtschafts-, Medizinal-, Montan-, Pharmazeuten-, Studenten-, Tierärzte- und Weinbaukalender. Nach einer Verlagsanzeige für Fromme’s Kalender für 1911 reichte das Angebot von Buch-Kalendern und Brieftaschen- und Portemonnaie-Kalendern zu Blatt-, Wand- und Pultkalendern sowie Block- und Fachkalendern.[56] Manche davon wurden nicht nur in deutscher, sondern auch in ungarischer, böhmischer, polnischer, italienischer und französischer Sprache hergestellt. Bei einzelnen Kalendern konnte man unter bis zu zehn verschiedenen Einbänden wählen.
Nach dem plötzlichen Tod von Otto Fromme im Jahre 1921 wurde die Firma von (Carl) Georg Fromme[57] und Viktor Reisser, Sohn des 1892 verstorbenen Gründers der bedeutenden Wiener Buchdruckerei Christoph Reisser’s Söhne, weitergeführt. Nach dem Tod von Carl Georg Fromme, im Jahre 1937 wurde die Firma bis 1938 von Reisser, Friedrich Meyer (Geschäftsführer von Anton Schroll und Koll.-Prok. bei L.W. Seidel & Sohn) und dem Sohn Carl Georg Frommes, Georg (Wilhelm Otto) Fromme[58], geführt. Auf die Weiterentwicklung während des Kriegs wird hier nicht eingegangen. Im November 1957 ging die Firma Carl Fromme – Anfang der 40er Jahre war die Firma Georg Fromme gegründet worden – in Liquidation. Infolge beendeter Liquidation wurde die Firma am 30. Juni 1958 aus dem Handelsregister in Wien gelöscht.[59]
p) Robert Mohr (Verlags- und Kommissions-Buchhandlung) [60]
 Die Verlagsbuchhandlung Robert Mohr war eines der wenigen Unternehmen, die auf Humoristika spezialisiert waren.[61] Die Firma wurde am 18. Februar 1889 in Wien gegründet. Der aus Scholkingen (Württemberg) in Deutschland gebürtige Mohr (* 11. 8. 1856) war im Jahre 1877 nach Wien gekommen, wo er seine erste Stellung als Sortimentsgehilfe bei der Buchhandlung Gerold & Co. antrat. Bevor er sich 1889 selbständig machte, war er auch für die Firma Manz tätig. Die Firma Mohr wurde mit der Vertretung des Bibliographischen Instituts (Leipzig), von dessen Verlag ein Auslieferungslager errichtet wurde, eröffnet. In den folgenden Jahren übernahm Mohr die Vertretungen von einer ganzen Reihe von größeren deutschen Verlagen, darunter der Deutschen-Verlags-Anstalt in Stuttgart (1905). Im Laufe dieser Entwicklung wurden die Vertretungen von wichtigen deutschen Zeitschriften wie Die Woche, Die Gartenlaube, Die Meggendorfer Blätter, Westermanns Monatshefte übernommen.
Die Verlagsbuchhandlung Robert Mohr war eines der wenigen Unternehmen, die auf Humoristika spezialisiert waren.[61] Die Firma wurde am 18. Februar 1889 in Wien gegründet. Der aus Scholkingen (Württemberg) in Deutschland gebürtige Mohr (* 11. 8. 1856) war im Jahre 1877 nach Wien gekommen, wo er seine erste Stellung als Sortimentsgehilfe bei der Buchhandlung Gerold & Co. antrat. Bevor er sich 1889 selbständig machte, war er auch für die Firma Manz tätig. Die Firma Mohr wurde mit der Vertretung des Bibliographischen Instituts (Leipzig), von dessen Verlag ein Auslieferungslager errichtet wurde, eröffnet. In den folgenden Jahren übernahm Mohr die Vertretungen von einer ganzen Reihe von größeren deutschen Verlagen, darunter der Deutschen-Verlags-Anstalt in Stuttgart (1905). Im Laufe dieser Entwicklung wurden die Vertretungen von wichtigen deutschen Zeitschriften wie Die Woche, Die Gartenlaube, Die Meggendorfer Blätter, Westermanns Monatshefte übernommen.
Mohr gliederte seinem Unternehmen alsbald einen Verlag an, dessen Produktion mit Hans Schließmanns Wiener Schattenbilder mit einem Text von Eduard Pötzl zu Weihnachten 1892 eröffnet wurde. In sechs Wochen waren vier Auflagen (4.000 Ex.) erschienen und verkauft. Ein Jahr danach erschien Pötzls Weltliches Kloster, und damit begann die Reihe Mohrs Wiener Humoristika mit Werken von beliebten Wiener Humoristen wie Chiavacci, Hirschfeld, Müller-Guttenbrunn, Pötzl, Stüber-Gunther und anderen. Zu den Illustratoren dieser Reihe zählte u. a. Kolo Moser (Pötzl, Bummelei; Johannes Ziegler, Wiener Stadtgänge) und Theo Zasche (Pötzl, Das weltliche Kloster; Launen). 1910 umfaßte diese Reihe bereits 33 Bändchen. Insgesamt konnten 50 Bändchen erscheinen. Zu Weihnachten 1906 erschienen die 18 Bände umfassenden Gesammelten Schriften Eduard Pötzls.
Im Jahre 1927 konnte Mohr, der den Verlagsbetrieb zugunsten von Buchhandlung und Auslieferung aufgab, schon „50 Jahre Buchhändler“[62] und zwei Jahre darauf sein 40jähriges Firmenjubiläum feiern.[63]
Als der Gründer am 13. Februar 1934 in Wien starb, wurde die Firma von seinem gleichnamigen Sohn weitergeführt. Sie überdauerte den Zweiten Weltkrieg – nicht zuletzt, weil sie als „kriegswichtig“ galt – und ging Anfang 1961 auf Dr. Gottfried Berger über.[64]
q) Halm & Goldmann[65] (Buchhandlung, Antiquariat, Kunsthandlung, Verlag)
Im Jahre 1848 wurde ein Sortiments- und Verlagsgeschäft mit vorwiegend medizinischer Literatur in Würzburg vom 26jährigen Paul Halm gegründet. Um seinem Unternehmen mehr Raum zur Entwicklung zu geben, entschloß sich Halm 1867, sein Geschäft nach Wien zu verlegen. Drei Jahre später trat ein junger Gehilfe namens Sigmund Goldmann[66] in das Geschäft ein. Mittlerweile hatte Halm in der Babenbergerstraße eine Antiquariatsbuchhandlung etabliert und begonnen, alljährlich mehrere Kataloge unter dem Titel Österreichische Bücherzeitung zu versenden. Als er 1873 eine Filiale in Triest eröffnete, ereilte ihn im 51. Lebensjahr während einer Choleraepidemie der Tod. Als Geschäftsführer fungierte nunmehr Sigmund Goldmann.
Schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts verlegten Halm & Goldmann ihren Produktionsschwerpunkt auf das aufstrebende Gebiet des Kunstgewerbes. So entstanden mehrere mit Farbtafeln geschmückte Prachtbände, wie z.B. Ornamente südslawischer Haus- und Kunstindustrie. Anfang der 80er Jahre importierte die Firma die damals in Europa noch wenig bekannten japanischen Originalbilderbücher und Illustrationswerke, deren Absatz ins Enorme ging. Kurz nach der Jahrhundertwende im Jahre 1902 traten zwei jüngere Kräfte in die Firma ein, und zwar der Schwiegersohn Goldmanns, Hermann Gall,[67] als Mitbesitzer und Josef Kende[68] als Geschäftsführer des Antiquariats. So erfuhr das Unternehmen nicht nur eine räumliche Erweiterung, sondern auch der Verlag wurde durch die Aufnahme verschiedener Werke, wie z. B. des umfangreichen Wurzbach’schen Künstlerlexikons, neu belebt. Aber auch Werke wie das Niederländische Künstlerlexikon und die Poetischen Werke in sechs Bänden von Alexander Petöfi zierten das Verlagsangebot.
Im Jahre 1907 mußten Halm & Goldmann nach 40 Jahren ihren Standort in der Babenbergerstraße verlassen, und zu diesem Zweck wurde die seit dem Jahre 1875 am Opernring 19 bestehende Kunsthandlung Max Tinter erworben.
Obwohl Halm & Goldmann eher auf dem Gebiet der Kunst beheimatet waren und der neue Alleininhaber (seit Mai 1917) nach dem Tode Sigmund Goldmanns im Jahre 1916 diese Richtung besonders pflegte, ging man ab 1910 mit dem Schriftsteller und Kabarettisten Fritz Grünbaum (1880-1940) ein Vertragsverhältnis ein. So erschienen die nächsten zwei Jahrzehnte hindurch die Serien von „Neuen Dichtungen“ Verlogene Wahrheiten sowie Neue Gedichte bei Halm & Goldmann.
Als der Inhaber Hermann Gall 1932 im 60. Lebensjahr plötzlich starb, ging die Firma am 17. Jänner 1933 in den Besitz der Witwe Elsa Gall (* 27.7.1882) über, die den Betrieb zunächst als Kunsthandlung, einige Jahre später auch wieder als Kunstverlag führte.
Im März 1938 kam es zu einer überaus raschen Arisierung bzw. Neuübernahme der Firma Halm & Goldmann. Sie galt bereits seit 31. März 1938 als „arisiert“ und wurde bereits seit 1. April 1938 als „Offene Handelsgesellschaft“ geführt. Es begann aber alles schon am 13. März 1938 mit einer Einschüchterung. An diesem Tag der „Heimkehr ins Reich“ kannte der Jubel keine Grenzen: Es erschienen bei der Geschäftsinhaberin einige „nicht berechtigte Personen“ (Gall), um eben eine „Beschlagnahme“ vorzunehmen. Sie entkamen mit kleinen Sparkassabüchern und Bargeld im Wert von etwa RM 2.482,55, wurden aber von der Polizei, die den Betrag vermutlich sicherstellte, verhaftet. Die Beute sah die Inhaberin von Halm & Goldmann allerdings nicht mehr.
Der „jüdische“ Firmenname verschwand fast über Nacht, und die neue Firma, die erst am 20. Jänner 1939 ins Handelsregister eingetragen wurde, lautete: „Edhoffer & Kasimir“ nach den „Käufern“, dem 57jährigen Maler Luigi Kasimir (18.4.1881-5.8.1962) und dem 52jährigen Kunstverleger Ernst Edhoffer (8.9.1886-12.6.1960). Im November 1938 hatte die Firma Halm & Goldmann am Opernring einen Wert von ungefähr RM 150.000 und einen Schätzwert von RM 83.333,32. Der verlangte Preis war RM 50.000, wovon Kasimir 30.000 und Edhoffer 20.000 zahlen sollten. Aber so viel Barvermögen hatten Ariseure zumindest für solche Zwecke kaum, doch die Tatsache, daß sie meist überhaupt kein Geld hatten, war selten ein Hindernis. Daher sollte die Zahlung in Raten erfolgen und bis längstens 2. 9. 1940 abgetilgt sein.
Spätestens im Mai 1939 war die rechtmäßige (also trotz „Verkaufs“) Inhaberin nach Kalifornien, USA, ausgereist. Die sehr wohlhabende Dame verlor eine wertvolle Liegenschaft im 3. Bezirk sowie unzählige Wertpapiere und dergleichen. Nach Zahlung der Ausreisespesen, der Reichsfluchtsteuer und der Einkommensteuer verblieb ihr im November 1938 ein Barvermögen von rund RM 5.000. Für die tatsächliche Zahlung der „Kaufsumme“ für den Verlag bzw. die Kunsthandlung Halm & Goldmann gibt es keinen Beleg. Lediglich der Arisierungsbetrag von RM 3.300 ist ausgewiesen.[69] Erst am 4. März 1969 wurde die Firma aus dem Wiener Handelsregister gelöscht.[70]
r) Wiener Verlag (Sep.-Cto. L. Rosner)
 Zu den wenigen vor 1918 neugegründeten belletristischen Verlagen, die außerdem nicht von zugereisten Deutschen ins Leben gerufen wurden, gehörte der „Wiener Verlag“.
Zu den wenigen vor 1918 neugegründeten belletristischen Verlagen, die außerdem nicht von zugereisten Deutschen ins Leben gerufen wurden, gehörte der „Wiener Verlag“.
Obwohl der „Wiener Verlag“ als solcher erst im „Herbst 1899“ gegründet wurde, einen der frühesten „Nur-Verlage“ darstellt und bis zu seinem unaufhaltsamen Untergang 1908 eine wechselvolle Geschichte hatte, steht er in enger Verbindung mit einer in Wien sehr bekannten und allgemein geschätzten Persönlichkeit: Leopold Rosner. Die Verbindung bestand allerdings nicht durch die Person, sondern durch den übernommenen Firmennamen.
Rosner, 1838 in Pest geboren, war einige Jahre lang Schauspieler, bevor er sich 1861 dem Buchhandel widmete. Nach Gehilfentätigkeit bei Wallishauser in Wien etablierte er sich zehn Jahre später als Verleger und Sortimenter unter den Tuchlauben im 1. Bezirk.
Am 7. August 1874 wurde Carl Leopold Rosner als Inhaber der Firma „L. Rosner“ ins Wiener Handelsregister eingetragen.[71] Nach einer schweren Erkrankung im Jahre 1885 war Rosner gezwungen, die Geschäftsleitung abzugeben. Er verkaufte sodann seinen Theaterverlag an die Wallishausser’sche Hofbuchhandlung im selben Jahr. Das Sortimentgeschäft neben den übrigen Verlagsartikeln ging an August Schulze über. Rosner war das, was man als „allrounder“ bezeichnen würde. Selber ein Schaffender, war er auch Bearbeiter und Übersetzer von französischen und ungarischen Werken und hatte den „Spürsinn für die Kommenden und den Unternehmungsgeist und Mut des strebenden Verlegers“.[72] 126) Mit Heinrich Laube teilte Rosner das Verdienst, in einem Schreibenden namens L. Gruber den Autor, der später als Ludwig Anzengruber das Publikum eroberte, entdeckt zu haben. Er veranlaßte den „Wiener Spaziergänger“ Daniel Spitzer, seine Feuilletons zu sammeln und brachte die Klassiker der Wiener Geschichte, Friedrich Schlögl und Ferdinand Kürnberger, sowie Adolf v. Wilbrandt und Albrecht Wickenburg heraus. Auch schuf Rosner das „Neue Wiener Theater-Repertoire“, in dem viele Burgtheaterstücke zum Abdruck gelangten. „Die intensive Pflege heimischer literarischer Produktion war von großen moralischen Erfolgen begleitet, der Theaterbuchhändler Rosner war in ganz Wien bekannt und beliebt und sein Laden war viele Jahre hindurch das Stelldichein der literarischen Kreise; minder günstig waren die materiellen Resultate des Verlegers, der sich oft bloß vom idealen Standpunkte leiten ließ.“ (Fr. Schiller, a. a. O., S. 464)
Am 23. Juli 1889 wurde der neue Firmenwortlaut – „Buchhandlung L. Rosner“ – ins Handelsregister eingetragen. Gleichzeitig wurde Rosner als Firmeninhaber gelöscht. Genau zehn Jahre später, am 17. März 1899, wurde nun diese Firma aus dem Handelsregister gelöscht. Am selben Tag wurde das Geschäft in eine Kommandit-Gesellschaft umgewandelt mit Carl Wilhelm Stern[73] als öffentlichem Gesellschafter und Franz Ludwig Liebeskind in Leipzig als Kommanditist.[74]
Gegen Ende 1899 begannen Bücher mit dem Impressum „Wiener Verlag. (Buchhandlung L. Rosner-Sep.-Cto.)“ zu erscheinen. Der Gründer des Unternehmens war der ältere Bruder Egon Friedells, Oskar Friedmann,[75] aber in welcher geschäftlichen Verbindung die Firma „Wiener Verlag“ zum Inhaber der „Buchhandlung L. Rosner“, C.W. Stern, stand, läßt sich nicht rekonstruieren. Man kann jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der „Nur-Verleger“ Friedmann, um das Problem der Beschaffung einer Konzession zu umgehen, die Verbindung zu einem konzessionierten Unternehmen. suchte. Wie dem auch sei, man begann mit großem Elan: bis September 1900 waren bereits 20 Titel auf dem Markt – Essays, Romane, Novellen, Theaterstücke – und weitere drei für September angekündigt.
Schon 1901 soll der am 7. April 1879 in Wien geborene Jungschriftsteller Fritz Freund seine Absicht bekannt gemacht haben, den Verlag zu übernehmen.[76] Am 6.11.1902 bewarb sich Freund um die Mitgliedschaft bei der Corporation der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhändler. Im entsprechenden Protokoll heißt es:
Ich will eine neue Conzession für den Verlagsbuchhandel Wiener Verlag Rosner erwerben. Der Betrieb soll im I. oder IX. Bezirk stattfinden; meine Firma wird lauten Wiener Verlag.
Daß Freund bereits 1902 mit dem Wiener Verlag Kontakt hatte, geht ferner daraus hervor, daß er in einer in diesem Jahr erschienenen Publikation Variété. Ein Buch der Autoren des Wiener Verlages (Umschlagzeichnung von Emil Orlik) mit einer Lyrikprobe vertreten war. Insgesamt gab es meist Originalbeiträge von 26 Autoren, darunter Raoul Auernheimer, Hermann Bahr, Felix Dörmann, Stefan Großmann, C. Karlweis, Felix Salten, Hugo Salus, Richard Specht.
Spätestens im März 1903 war Friedmann aus dem Verlag ausgeschieden und dessen Leitung von Freund übernommen worden. So heißt es in einem Schreiben der Corporation an das Magistratische Bezirksamt vom 9. 3. 1903:
Herr Fritz Freund hat den Buchhandel in der Firma L. Rosner. Wien 1, Franzensring 16 ordnungsgemäß erlernt und seine Tätigkeit speziell dem Verlage u. zwar in der Firma “Wiener Verlag“ gewidmet, welches Geschäft er in der letzten Zeit erworben hat. Es ist nun wünschenswert sowohl im Interesse der Autoren als auch des Druck- und Buchgewerbes, daß die litterarische und verlegerische Tätigkeit in Wien gehoben werde und spricht sich die Corporation deshalb unbedingt dafür aus, daß sowohl in diesem als auch in ähnlichen Fällen die Conzession für den Verlagsbuchhandel ohne Bedenken erteilt werde.
Und es war erst unter der Leitung Freunds, daß der an sich recht produktive Verlag eine ungeheure Ausdehnung annahm. Freund übernahm den Verlag mit einem Kapital von 20.000 Kronen, die er von seiner Mutter erhalten hatte, und am 26. April 1904 wurde der „Wiener Verlag Fritz Freund“ in das Register für Einzelfirmen (Band 38, pag. 72) beim Wiener Handelsgericht eingetragen. Dies geschah, kurz nachdem Freund in einer Sitzung der Corporation der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhändler am 7. April 1904 seine Konzession als Verleger erhalten hatte.[77] Eine Anzeige in der Buchhändler-Correspondenz vom 11. Mai 1904 (S. 298) scheint darauf hinzuweisen, daß Freund vorhatte, dem bestehenden Verlag einen leicht veränderten Namen zu geben, nämlich „Wiener Moderner Verlag“.[78] Doch übernahm sich Freund gewaltig. Dem Geschäft gab er eine solche Ausdehnung, daß er gezwungen war, übermäßigen Kredit in Anspruch zu nehmen. Auch die Regiekosten, die monatlich 14.000 Kronen betrugen, waren für die Verlagsbranche viel zu hoch. Nicht, daß der Verlag keine außerordentlich großen Verkaufserfolge aufzuweisen hatte. Im Gegenteil. Aber für jeden „Schlager“-Beispiele werden weiter unten angeführt-gab es ein Mehrfaches an „Nieten“. Da wurden langsam die Mittel zu knapp und die Verlegenheiten permanent. Um sich eine finanzielle Verschnaufpause zu verschaffen, entschloß sich Freund, sein Unternehmen in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln. Am 12. Oktober 1906 ließ er den „Wiener Verlag Fritz Freund“ aus dem Handelsregister löschen, um am selben Tag den „Wiener Verlag. Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei Ges.m.b.H.“ in Wien V., Wienstraße 89a unter Register C 1, 34 eintragen zu lassen. Gegenstand des Unternehmens – Betrieb des Verlagsbuchhandels sowie der Kunstdruckerei und der Lithographie.[79]
Das Stammkapital betrug 40.500 Kronen, doch existierte die Summe mehr auf dem Papier als in Wirklichkeit. Es handelte sich bis auf die eingezahlten 500 Kronen des Wiener Verlag-Autors und nunmehrigen zweiten Geschäftsführers Willi Handl[80] um eingebrachte Vermögenswerte, die also nicht unbedingt mit flüssigem Betriebskapital zu verwechseln waren. Als der Gesellschaftsvertrag beim Notar aufgesetzt wurde, gehörten 80 % der Geschäftsanteile Freund und die restlichen 20% Handl.
Aus dem „Verzeichniss von Herrn Fritz Freund in Anrechnung auf seine Stammeinlage eingebrachte Werte“, das dem Notariatsakt beiliegt,[81] geht hervor, daß sich diese Werte zu 81% aus den ebenfalls genauestens angeführten und aufgeschlüsselten Lagerbeständen zusammensetzten. Immobilien (Schreibtisch, Stehpulte etc.), Bilder (Klimt, Löffler, Hollitzer, Orlik, Kollwitz usw.) und Außenstände machten den Rest aus. Bereits die Größe des Lagers mußte ein Alarmzeichen gewesen sein, für richtige Geschäftsleute auf jeden Fall.
Das vorhin erwähnte Verzeichnis führte nicht weniger als 136.230 Bände bzw. 210 verschiedene Titel an. Von manchen Titeln gab es anläßlich der Umwandlung mehr als 4.000 Exemplare auf Lager, so z. B. Arthur Schnitzlers Reigen (4.010), Hans Kirchsteigers Beichtsiegel (4.200), Karl Schönherrs Caritas (4.350), Dostojewski (10.000), Kirchsteigers Patrina (5.000). Nach einer vorsichtigen Schätzung dürfte die Produktion insgesamt zwischen 250 und 300 Werke umfaßt haben. Demgegenüber heißt es Anfang 1906 in einem längeren Aufsatz über den Wiener Verlag in der Zeitung Die Zeit (Beilage “Die Sonntags-Zeit“, 21. 6. 1906, S. 6), der Verlag habe „bisher mehr als dreihundert Werke ediert“.
Daß die Umwandlung in eine Ges. m. b. H. bloß eine Flucht nach vorne darstellte, die allerdings dem geschäftlichen Vorwärtsdrang bzw. der Produktionsausweitung keineswegs im Wege stand, geht daraus hervor, daß schon Mitte 1907 allerorts von „Zahlungsschwierigkeiten“ beim Wiener Verlag gemunkelt wurde. Selbst die Österreichisch-ungarische Buchhändler-Correspondenz, die Fritz Freund und den Wiener Verlag sieben Jahre lang bis auf die Publizierung von negativen Berichten erfolgreich ignorierte, vermerkte, daß diese Nachricht „in eingeweihten Kreisen nicht überrascht“ habe[82]: „man hat vielmehr den Zusammenbruch der Firma schon lange vorausgesehen“ (ebda.). Der Verlag strebte durch den Advokaten Dr. Robert Lazarsfeld ein Arrangement mit seinen Gläubigern an. Für Fachbeobachter und Branchenkenner besonders verwunderlich war die enorme Höhe der Passiven, die im ganzen angeblich eine halbe Million Kronen (!), also mehr als das Zwölffache des Stammkapitals, betragen haben sollen. Es schien klar zu sein, daß die Gläubiger kaum viel von ihrem Geld wieder sehen würden. Die Redaktion der Buchhändler-Correspondenz fand diesen Zusammenbruch für die österreichische Verlagsindustrie deshalb so bedauerlich, „weil sie künftig auch für gesunde Unternehmungen noch weit schwerer Geld finden wird als bisher“. Nachsatz zu diesem Lamento:
Im Interesse des österreichischen Buchhandels muß daher festgestellt werden, daß er die Geschäftsgebarung des „Wiener Verlag“ niemals gutheißen konnte und daß er mit dieser Firma nur in sehr loser Verbindung stand. (ebda., S. 87)
Eine etwas ausgewogenere Beurteilung der Situation beim „Wiener Verlag“ lieferte Friedrich Schiller in seinem „Wiener Brief“ nach Leipzig an das Börsenblatt:
Von der Verlagshandlung wußte man, daß sie so glücklich war, einige „Schlager“ zu bringen, und man kalkulierte, daß diese Treffer ein ganz bedeutendes Stück Geld eingetragen hatten. Aber die Nieten! Der junge, wohl zu optimistische Verleger entwickelte eine fieberhafte Tätigkeit und schüttelte die Novitäten nur so aus dem Ärmel. Da wurden denn die Mittel zu knapp und die Verlegenheiten permanent; um sie zu besiegen, griff der Verleger zu dem sonderbaren Ausweg, die Novitäten noch vor der Ausgabe zu verramschen. jetzt werden Anstrengungen gemacht, die Firma in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, wobei natürlich die Hauptgläubiger zu Hauptaktionären würden. Hoffen wir, daß das Projekt zustande kommt; denn ein Überfluten des Büchermarkts mit den Vorräten könnte dem Buchhandel nicht erwünscht sein. [83]
Das Projekt dürfte nicht zustandegekommen sein. Das „Ende“ ließ aber doch auf sich warten. Ein Zeichen für den Beginn vom Ende war die Einstellung der teuren Anzeigen im Börsenblatt, die am 4. April 1907 mit der Ankündigung der 5. Auflage von Robert Musils Erstlingsroman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß erfolgte. Musil war somit eines der Opfer des Niedergangs, denn der Wiener Verlag ging pleite, gerade als sein Werk ein ungeahnter und rascher Verkaufserfolg zu werden versprach.
Der Tag der „Abrechnung“ für den Besitzer des Wiener Verlags war am 7. Mai 1908, als er vor einem Wiener Erkenntnissenat stand und sich wegen selbstverschuldeter Krida (§ 486 St. G.) und Exekutionsvereitelung verantworten mußte. Freund hatte bald die Unmöglichkeit eingesehen, das Geschäft weiter fortzufahren, denn sein Schuldenstand betrug 176.205 Kronen, denen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nur ganz geringe Aktiven gegenüberstanden. Freund hingegen bezifferte den Wert seines Warenlagers mit 400.000 Kronen. Nur: Die Bücher und Werke waren längst gepfändet, z.T. schon exekutiv verkauft worden. Außerdem wurde Freund jener Geschäftsdreh, den er bei der Umwandlung seiner Firma in eine Ges.m.b.H. angewendet hatte, zum Verhängnis. Er habe, so die Anklage, Vermögensobjekte seinen Gläubigern entzogen, um sie in dem nur scheinbar errichteten neuen Unternehmen wieder als Aktivpost anführen zu können.
Wegen dieser und anderer Praktiken, auf die wir noch kurz eingehen werden, kamen die hohen Passiven zustande. (Manche Quellen sprechen von 150.000 Kronen, manche von 270.000, andere von 176.205.) Und das, obwohl Freund z. B. mit dem Werke Aus einer kleinen Garnison (Auflage über 1/2 Million!) von Bilse (pseud. Fritz v. d. Kyrburg) 120.000 Kronen und mit Schnitzlers Reigen allein 20.000 Kronen verdient hatte.[84] Freund verteidigte sich u. a. mit der Angabe, daß er an bekannte deutsche und österreichische Autoren Buchhonorare von über 20.000 Kronen bezahlt habe, deren Werke jedoch so geringen Absatz fanden, daß er starke Verluste erlitt. Solche letzten Endes überhöhten Honorare würden einen Verkauf von 40.000 und mehr Exemplaren bedingen, was zugleich auf Freunds Risikobereitschaft schließen läßt.
Sein Verteidiger, Dr. Gustav Morgenstern, betonte in seinen Ausführungen den regen Eifer seines Klienten, der an den schlechten Verhältnissen und an dem Verhalten seines Kompagnons (Willi Handl) gescheitert sei. Der Senat erkannte den Angeklagten für schuldig und verurteilte ihn zu drei Wochen strengen Arrests.[85]
Womit der Wiener Verlag noch nicht juristisch „tot“ war. Aber aus den genannten Gründen war Freund auch licht in der Lage, seinen Vertragsverpflichtungen nachzukommen, wie etwa im Fall von Schnitzlers Reigen.[86]
1910 wurde Fritz Freund vom Handelsgericht aufgefordert, seine Firma zu liquidieren und aufzulösen, was allerdings daran scheiterte, daß die Geschäftsanteile gepfändet waren. Trotz der Absicht, den Geschäftsbetrieb mit 1. April 1911 wieder aufzunehmen, ist es dazu nicht gekommen. Die Firma blieb eine „Karteileiche“, bis sie am 1. Jänner 1929 aus dem Handelsregister gelöscht wurde. Fritz Freund blieb der Buchhandelsbranche treu, schaffte es im April 1911, in die Zeitung zu kommen, ins Gefängnis des Strafgerichtshofes in Budapest gesteckt und wegen Vergehens gegen die Sittlichkeit angeklagt zu werden, nachdem er bei einigen Budapester Buchhändlern mit „pornographischen Büchern“ hausieren gegangen war.[87] Aber mit ähnlichen Vorfällen ist seine Verlegerlaufbahn reichlich besät. In den 20er und 30er Jahren gab er eine Filmzeitschrift (Österreichische Filmzeitung) heraus und konnte nach der Enteignung 1938 unter Verlust seines ganzen Eigentums 1939 nach England auswandern.[88]
Aber das abwechslungsreiche Leben des Wiener Verlags liegt einerseits in der bunten Palette der Produktion, andererseits in den juristischen Vorgängen rund um den Verlag und dessen Inhaber. Es würde zu weit führen, alle Vertreter der „Wiener Moderne“ anzufahren, deren Werke zwischen Ende 1899 und März 1907 im Wiener Verlag erschienen. Eines der ersten Werke (Dezember 1899) stammte von Felix Salten. Hermann Bahr, über den wahrscheinlich viele junge Autoren zum Verlag g kommen sind, veröffentlichte nicht weniger als sechs seiner Bücher im Wiener Verlag, darunter den Essay Secession mit einer Umschlagzeichnung von Joseph Olbrich. Aber auch Felix Dörmann, Karl Schönherr, Stefan Großmann, Hugo Salus, Raoul Auernheimer, Eugen Guglia, Leopold Lipschütz, Theodor Herzl, Max Kalbeck, Hans v. Kahlenberg, Max Mell, Alice Schalek, Moritz Heimann, Paul Busson, Ferd. v. Saar, Robert Musil, Richard Schaukal, Paul Wertheimer u. v. a., um ein paar Österreicher zu nennen, gehörten zeitweise zu den Verlagsautoren.
Einige Bücher erlebten riesige Auflagen, und nicht selten waren es Werke, die in Deutschland früher oder später verboten wurden. Führend waren Bilses Aus einer kleinen Garnison, Mirbeaus Tagebuch einer Kammerjungfer, John Grand-Carterets Er (Karikaturen über Kaiser Wilhelm II.; Aufl. ca. 36.000), Hans Kirchsteigers Das Beichtsiegel (in wenigen Tagen nach Erscheinen 13.000 verkaufte Exemplare!).
Im Jahre 1903 glaubte Freund eine Marktlücke entdeckt zu haben, als er im Mai die neue Buchserie „Bibliothek berühmter Autoren“ und Anfang Oktober 1904 die „Bibliothek moderner deutscher Autoren“ ins Leben rief. Die Erwähnung gerade dieser zwei Serien, deren einzelne Werke durchaus unterschiedlichen Erfolg hatten, führt zwangsläufig zu zwei Merkmalen des Wiener Verlags überhaupt: Werbung und Ausstattung.
Bis Mitte Juni 1905 erschienen schließlich 50 Bände der „Bibliothek berühmter Autoren“. Das Angebot bestand ausschließlich aus Übersetzungen nicht-deutschsprachiger, meist skandinavischer, französischer, polnischer, russischer oder englischer Autoren. Die Bilanz laut Eigenwerbung:
Diese in ihrer Art einzig dastehende Sammlung guter moderner Romane und Novellen von nur bekannten, allerersten Autoren zu dem billigen Preise von 50 Pfennigen für den 120- 160 Seiten starken Band hat einen ganz einzigen Erfolg gehabt, indem innerhalb eines Jahres weit über 250.000 Bände verkauft wurden. Wir empfehlen allen Firmen, welche unsere „BIBLIOTHEK BERÜHMTER AUTOREN“ noch nicht kennen, uns einen Probeauftrag zu überweisen, und sind wir überzeugt, an denselben von nun an stetige Abnehmer zu finden. (Börsenblatt, Nr. 132, 10. 6. 1904, S. 5064)
Dies sei „ein glänzender Beweis für die Absatzfähigkeit unseres Unternehmens“. Von einer neuen Serie dieser Reihe seien „jetzt acht Tage nach Ausgabe“ (ebda.) 50.000 Exemplare verkauft worden.
Zur Gestaltung der „mehrfarbigen brillanten Umschläge“ zog Freund erstklassige Künstler heran. Von den 50 Bändchen stammten u.a. 15 Umschläge von Berthold Löffler, 7 von Leo Kober, 6 von Leopold Forstner und 3 von Fritz Schönpflug. Auch auf die Wahl des Vorsatzpapiers und die gediegene Ausstattung wurde großer Wert gelegt.
Mit genau derselben Werbestrategie ging Freund etwas mehr als ein Jahr nach Beginn der „Bibliothek berühmter Autoren“ an die Schaffung einer zweiten Buchserie heran. Er scheute keine Kosten, um unzählige ganzseitige Einschaltungen im Börsenblatt zu plazieren, und hatte er im ersten Anlauf Erfolg, so warb er weiterhin mit eben diesem Erfolg. Der Wiener Verlag kündigte am 26. Oktober 1904 sein neues Serienunternehmen folgendermaßen im Börsenblatt an:
Es gereicht uns zur besonderen Freude, Ihnen von einem großangelegten Unternehmen Mitteilung machen zu können, das geeignet erscheint, Ihr Interesse im stärksten Maße wachzurufen, und das Ihnen einen dauernden und großen Verdienst eröffnet.
Das Publikum hat sich erfreulicherweise in den letzten Jahren wieder dem deutschen Buche zugewendet, u. zw. waren es vor allem billige deutsche Bücher, die, ohne gerade Sensationsbücher zu sein, eine so enorme Auflagenhöhe erreichten, wie sie selbst französischen und englischen Büchern nur in seltenen Fällen beschieden ist.
Diese deutlich erkennbare und auch allgemein anerkannte Tendenz zum billigen deutschen Buch hin, veranlaßt uns, Anfang Oktober unter dem Titel „Bibliothek Moderner Deutscher Autoren“ die ersten zehn Bände einer neuen Bibliothek herauszugeben, und glauben wir mit berechtigtem Stolz sagen zu können, daß der deutsche Buchhandel etwas derartig Befriedigendes, sowohl was Ausstattung, Wohlfeilheit, Qualität und Namen der Autoren betrifft, noch nicht geboten hat. – Wir haben keine materiellen Opfer gescheut, um mit einer Reihe allererster Namen eröffnen zu können und sind durch bereits abgeschlossene Verträge in die glückliche Lage versetzt, auch die weiter erscheinenden Serien zumindest auf der Höhe der ersten zu halten. (Nr. 250, S. 9310)
50.000 Exemplare waren 14 Tage nach erfolgter Ausgabe bar verkauft worden, so daß das 6.-10. Tsd. ausgedruckt werden mußte (Börsenblatt, Nr. 262, 10.11.1904, S. 9928). Die Werbung wurde noch verstärkt, wobei die „Psychologie“ gleich blieb:
Wir haben mit dieser Bibliothek etwas ganz Konkurrenzloses und in seiner Art einzig Dastehendes geboten.
Die Bände rühren von den bekanntesten deutschen Autoren her, sind 140 bis 160 Seiten stark, apart ausgestattet und bilden wegen ihrer modernen, schönen Titelbilder eine Zierde jedes Schaufensters.
Einzelne Firmen haben bisher über 1.000 Exemplare bezogen. Dieser Erfolg übertrifft unsere Erwartungen weit, und danken wir den Herren Kollegen bestens für das dem Unternehmen entgegengebrachte Interesse. (ebda.)
In dieser Reihe erschienen insgesamt 20 Titel (bis September 1905), deren erster von Arthur Schnitzler stammte, die Novelle Die griechische Tänzerin, „welche einen ganz außerordentlichen Erfolg hat“ (Werbung, in: Börsenblatt, Nr. 6, 9.1.1905, S. 260). Innerhalb von acht Wochen waren über 80.000 Exemplare der Reihe verkauft worden und von Schnitzlers Novelle war im Jänner 1905 schon das 11.-15. Tsd. im Druck. Zu den weiteren Autoren dieser Reihe zählten u. a. Hugo von Hofmannsthal, Felix Dörmann, Carl Hauptmann, Heinrich Mann, Johannes Schlaf, Hans v. Kahlenberg, Felix Salten, Otto Ernst, Siegfried Trebitsch. Wiederum waren die farbigen Umschläge „von allerersten Zeichnern“ wie Heinrich Vogeler, Walter Hampel, Josef Engelhardt und Emil Orlik gestaltet worden, damit die Bände sich „spielend aus dem Schaufenster“ (Werbung) verkaufen würden.
So viel Werbeaufwand hatte kaum ein anderer österreichischer (belletristischer) Verlag aufzuweisen, und obwohl der Wiener Verlag außerordentlich viel im Börsenblatt annoncierte (und nicht ein einziges Mal in der Österreichisch-ungarischen Buchhändler-Correspondenz seine Bücher anzeigte), gab er außerdem für Auslagendekoration – Streifen usw. -Werbeprospekte für einzelne Verlagswerke usw. sehr viel Geld aus. Ein Beispiel hiefür ist die umfangreiche Werbung (im Börsenblatt und anderswo) für Arthur Schnitzlers Reigen, der im April 1903 beim Wiener Verlag auf den Markt kam.
Es versäume keine Firma, wenigstens zwei Exemplare zur Probe mit 40% zu bestellen. Das Buch steht einzig in seiner Art da und macht beispielloses Aufsehen. Einige Firmen haben bereits dreihundert Exemplare dieses Buches verkauft. Buchhandlungen in Sommerfrischen und Badeorten können spielend 100 und mehr Exemplare absetzen. Auffallende Schleifen, welche die oben angeführten Besprechungen enthalten, stehen für die Auslage zur Verfügung. (Werbetext im Börsenblatt, Nr. 12, 27.5.1903, S. 4244).
Der Verlag kam mit den Bestellungen und der Lieferung nicht nach, aber eben dieser Umstand sollte die „Begehrbarkeit“ des Buches erhöhen. Es sei nämlich zu erwarten, „daß auch diese Auflage gleich nach Erscheinen vergriffen ist“. In sechs Wochen wurden 6.000 Exemplare verkauft (Börsenblatt, Nr. 141, 22.6.1903, Umschlag). Von diesem „Buch der Saison“ hieß es dementsprechend in der Werbung: „Wir verkaufen täglich 200-300 Exemplare“ (Börsenblatt, Nr. 170, 25.7.1903, S. 5774).
Anlaß zu weiterer verkaufsfördernder Werbung bot die bevorstehende öffentliche Lesung von Schnitzlers Reigen durch Hermann Bahr am 8. November 1903 im Bösendorfersaal in Wien:
Diese Vorlesung ist ein literarisches Ereignis allerersten Ranges, welches das außerordentlichste Aufsehen machen und das stärkste Interesse für das Buch hervorrufen wird. Alle Zeitungen Deutschlands und Österreichs werden ausführliche Berichte über diese Vorlesung bringen, wodurch die Nachfrage eine sehr starke sein wird. Wir bitten Sie daher, sich rechtzeitig mit Exemplaren zu versehen. (Börsenblatt, Nr. 252, 29.10.1903, S. 8657)
Die Veranstaltung mußte abgesagt werden . . .
Das 11.-14. Tsd. von Schnitzlers Reigen war bereits gegen Ende Februar 1904 vollständig vergriffen und das 15.-20. Tsd. für Anfang März angekündigt[89]), und das zu einem Zeitpunkt, wo der Verlag mit der Feststellung warb, daß „schon über 1.500 unerledigte Barbestellungen“ vorlagen. Doch im März 1904 erfolgte in Berlin die Beschlagnahme, so daß Lieferungen in Leipzig nicht mehr erfolgen konnten. Weitere Auflagen erschienen aber trotzdem. Die Gesamtauflage des Reigen beim Wiener Verlag betrug 35.000 Exemplare.[90]
Der Auftritt Fritz Freunds vor Gericht im Mai 1908 war weder sein erster noch sein letzter: Er stand seit 1903 in regelmäßigen Abständen entweder vor dem Richter oder in Urheberrechtsfragen mit Inhabern von Rechten in Streit. Sein Umgang mit Verlagsautoren und Mitarbeitern vor allem in Gelddingen dürfte – wie Prozeßberichte zeigen – nicht gerade großzügig gewesen sein. Wenn die Anklage nicht auf Verletzung der Sittlichkeit lautete, dann auf Ehrenbeleidigung, Vorenthaltung eines Honorars – wie im Fall seines Erfolgsautors Hans Kirchsteiger 1906, oder unautorisierte Übersetzung. In der Regel verlor Freund die Prozesse und gewann die gerichtlich nicht belangbaren Urheberrechtsstreitigkeiten. Einmal trat sogar der Mitbegründer der Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann, als Sachverständiger gegen ihn auf, als er einen bedeutenden deutschen Künstler mit einem minimalen Honorar abspeisen wollte.
Am „geschicktesten“ war der Inhaber des Wiener Verlags auf dem Gebiet der deutschen Übersetzungen aus skandinavischen und slawischen Sprachen. Unter Ausnützung aller Griffe hinsichtlich mangelnden Urheberrechtsschutzes verstand er es blendend, andere Verlage, die autorisierten Übersetzer oder auch die Autoren selber auszutricksen und eine Übersetzung in seinem Verlag erscheinen zu lassen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Er veröffentlichte ein Werk von August Strindberg, und zwar rasch und bevor Schweden offiziell der Berner Convention beitrat. Strindberg ging mit leeren Händen aus, der Übersetzer auch.
Es besteht kein Zweifel, daß der Wiener Verlag sowohl unter Oskar Friedmann als auch unter Fritz Freund die österreichische Verlagsszene auf dem Gebiet der jungen österreichischen Literatur wie auch des anspruchsvollen Buchschmuckes ungemein belebte. Er förderte auch jüngere Autoren wie den völlig unbekannten 25jährigen Robert Musil und ließ den gleichermaßen unbekannten 23jährigen Leopold Perutz aus Prag in seinem Oktober 1905 ins Leben gerufenen „Wochenschrift für Politik und Kultur“ Der Weg veröffentlichen. Als Verleger gelegentlich etwas „schlüpfriger“ Werke, die im Deutschen Reich, aber nicht in Österreich verboten wurden, und kirchenkritischer Romane, wie etwa derjenigen von Hans Kirchsteiger (z. B. Das Beichtsiegel, Der Weltpriester), zog er den Ärger katholischer Kreise auf sich und mußte im Februar 1905 eine 5stündige Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen. Der „unerhörte“ Vorfall war kurz darauf Gegenstand einer Anfrage im Haus der Abgeordneten.
Der Wiener Verlag fand in keinerlei Hinsicht einen Nachahmer . ..
[1] FRANZ GRÄFFER, Österreichische National-Encyclopädie, oder alphabetische Darlegung der wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten des österreichischen Kaiserthumes. 1. Band, A bis D. Wien: In Commission der Friedr. Beck’schen Universitäts-Buchhandlung, 1835, S. 407-409; hier S. 407.
[2] Über den k.k. Schulbücherverlag, der in der Zeit Maria Theresias gegründet wurde, gibt es eine derartige Fülle von Literatur sowohl aus Anlaß dieses oder jenes Jubiläums als auch in wissenschaftlichen Arbeiten, daß hier grundsätzlich auf eine Darstellung verzichtet wird.
[3] HERMANN GILHOFER, Der deutsche Verlags- und Sortimentsbuchhandel in Österreich seit 1860. In: Festnummer der Österr.-Ungar. Buchhändler-Correspondenz. Wien 1910, I. Teil, S. 40-47; bes. S. 45.
[4] Der Verlag Josef Weinberger war am 15. Oktober 1885 in Wien gegründet worden. Er befaßte sich zunächst mit der Herausgabe der Werke österreichischer Komponisten. Ein mit dem Verlag verbundenes Sortimentsgeschäft wurde bereits 1889 aufgegeben. Weinberger betätigte sich fortan nur mehr als Verleger. Das Geschäft erfuhr eine große Ausdehnung durch den erwähnten Ankauf des Artaria & Co. Verlags. Josef Weinberger, der dessen Verwaltungsrat angehörte, gilt in einem 1910 erschienenen Bericht über das 25jährige Jubiläum des „Verlags Josef Weinberger“, als Initiator der Universal-Edition. Die Autoren des Universal-Edition-Jubiläumskatalogs 1976 schrieben diese Tat dem Bankier Josef Simon (1854-1926) zu (S. 9). Siehe BC, Nr. 42, 19.10.1910, S. 595. Weinberger starb am 9.11.1928 im 73. Lebensjahr.
[5] Die „Geschichte der Firmen Artaria & Compagnie und Freytag-Berndt und Artaria. Ein Rückblick auf 200 Jahre Wiener Privatkartographie 1770-1970“ (ohne Verfasser, nicht im Handel) ist eine der detail- und materialreichsten Arbeiten über einen österreichischen Verlag bzw. über eine Buch- und Kunsthandlung. Diese vorbildliche Leistung, die die Entwicklung der Firma Artaria eingehend verfolgt, ist leider eine allzugroße Seltenheit in der Geschichtsschreibung des österreichischen Buchhandels- und Verlagswesens. Verf. dankt Herrn Prok. Wolfgang Kaiser für die Übermittlung eines Exemplars dieser Firmengeschichte. Weitere Literatur, besonders zur Familie Artaria: DURSTMÜLLER, zit. Anm. 2, S. 190; Nachruf auf Carl August Artaria von Carl Junker. In: BC, 60. Jg., Nr. 15, 9. April 1919, S. 213 f.; „August Artaria“ (Zum 100. Geburtstag). In: BC, 61. Jg., Nr. 30, 24. Juli 1907, S. 429 f.; In der NFP (A), Nr. 20.194, Di., 16. November 1920, S. 1, 2, 3, 4 findet sich eine sehr ausführliche Würdigung von Artaria durch Dr. ERNST GROSS. Siehe auch: NFP, 21.7.1907 und REINGARD WITZMANN, Aus den Anfängen des Verlages „Artaria & Comp.“ in: Der Verlag Artaria. Veduten und Wiener Alltagsszenen. Wien 1981, S. 11-13 (Ausstellungskatalog. Historisches Museum der Stadt Wien).
[6] „Fast noch härter als die Firma Manz wurde der Verlag L. W. Seidel & S. durch den Umsturz getroffen. Diese Firma war der führende Verlag auf militärwissenschaftlichen und überhaupt militärischem Gebiete. Auch sie hat sich in der Folge neuen Aufgaben zuzuwenden gesucht. Sie betätigt sich nun auf den Gebiet der Geschichte, Wissenschaft, Geographie, Mathematik und Technik.“ (CARL JUNKER, Der Verlagsbuchhandel, zit. Anm. 4, S. 4.)
[7] Siehe: Jubiläumskatalog des Verlages Anton Schroll & Co. Gegründet am 17. Januar 1884 in Wien. Erschienen im Januar 1934, Wien 1934, S. 4.
[8] Siehe ebda. Außerdem: BC, 75. Jg., Nr. 2, 31.1.1934, S. 8: „Fünfzig Jahre Anton Schroll & Co., Wien“, und BC, 60. Jg., Nr. 42, 12.11.1919, S. 683. Neuerdings erschien der Aufsatz „Hundert Jahre Schroll“ von KRISTIAN SOTRIFFER in: Anzeiger, Nr. 7, Anfang April 1984, S. 70 f. Laut Auskunft des Verlags wird dzt. an einer Verlagsgeschichte aus Anlaß des 100jährigen Jubiläums gearbeitet.
[9] Gremium/Strache. Schreiben des MBA für den 1. Bezirk der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt vom 28. 12. 1917. Verwiesen wird auf den kurzen Artikel von J. H. MARTON, Der Aufstieg eines Verlages. In: Sudetenland. Vierteljahresschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und Volkstum, 25. Jg., Heft 1, 1983, S. 23 f.
[10] Pilz war Mittelschulprofessor, Journalist und Schriftsteller. 1919-1923 war er für den Amalthea-Verlag in Wien tätig. Siehe das Schreiben Oskar Wieners an Hugo Salus vom 30.8.1917: „(…) mein Freund Dr. Pilz ist jetzt Leiter von Ed. Straches Verlag in Wien (…).“ (Autographensammlung Werner J. Schweiger , Wien).
[11] Siehe die Anzeige „Wiederholt und dringend bitten wir zu unterscheiden“. In: BC, 60. Jg., Nr. 13, 26.3.1919, S. 188.
[12] Der Verlag bestand im 19. Jahrhundert aus zwei Abteilungen, dem eigenen Verlag und dem Kommissionsverlag. Mitte des 19. Jahrhunderts z.B. diente Braumüller als Kommissionär für eine Reihe von staatlichen Stellen, darunter die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, das k.k. Finanzministerium und für das k.k. Ministerium für Gewerbe, Handel und öffentliche Bauten. Auffallend ist die im 19. Jahrhundert relativ hohe Zahl der bei Braumüller erschienenen Schulschriften für die Realschulen und Gymnasien. Ein detaillierter Umriß der Entwicklung dieser Firma findet sich in: SCHNATTINGER, zit. Anm. 9, S. 127-138. Eine 40seitige Broschüre “ 175 Jahre“, die im Jahre 1958 erschien, beinhaltet lediglich eine einzige Seite zur Geschichte des Verlags. Der Rest ist eine Ansammlung von erschienenen Titeln. Anders die 1983 anläßlich des 200-Jahr-Jubiläums erschienene Schrift: 200 Jahre Wilhelm Braumüller. Hier wird in einer Verlagschronik 1783-1983 („200 Jahre im Dienst der wissenschaftlichen Literatur“), verfaßt vom ehemaligen Verlagsleiter Josef Eckel, ein wichtiger Beitrag zur Geschichte dieser Firma geleistet. Sonstige Hinweise: „150 Jahre Haus Wilhelm Braumüller“, in: Anzeiger, 74. Jg., Nr. 32, 2.9.1933, S. 140; „Zum Gedächtnis Wilhelm von Braumüllers“, in: Börsenblatt, Nr. 65, 19.3.1907, S. 3004; Lexikon der deutschen Verlage. Eine Chronik der deutschen Verlagsfirmen, enthaltend die Geschichte der Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchverlage, der Kunst- und Musikverlage sowie der Katalogantiquare. Leipzig: Verlag Curt Müller & Co., 1930, S. 311. Die Auswahl von weniger als einem Dutzend österreichischer Verlage in diesem Werk ist etwas kurios. Zu L. W. Seidel, s. u. a. Anzeiger, Nr. 20, 15.10.1948, S. 4 sowie besonders: „125 Jahre. Das Haus am Graben 13 – ein Stück Buchhandelsgeschichte.“ In: 1848-1973. Jubiläumskatalog-Militaria allen Freunden dargebracht von der Buchhandlung Rudolf Krey. Wien 1973.
[13] Quelle: Nachruf auf Franz Deuticke von WILHELM MÜLLER, in: BC, 60. Jg., Nr. 28, 9.7.1919, S. 402 f.; „Franz Deuticke“, in: BC, Nr. 45, 5.11.1913, S. 609 f. (anläßlich der Eröffnung am 1. November 1863 der von Deuticke geführten Buchhandlung). Siehe vor allem: Franz Deuticke Verlag, Buchhandlung, Antiquariat 1878-1978. 100 Jahre einer W“ener Firma. Ein Rückblick nebst einigen Glossen und allgemeinen Bemerkungen, gewidmet den Freunden, Kunden und Autoren. Wien, April 1978 (29 S. m. 9 Abb.). Siehe noch „Hundert Jahre Franz Deuticke“. In: Anzeiger, 113. Jg., Nr. 12, Mitte Juni 1978, S. 98.
[14] Siehe Dr. PAUL TABORI, German publishers outside Germany. In: The Bookseller (London), January 13th, 1938: „This [Bermann-Fischer Verlag] belongs to the category of “cautious publishers“, just as the Roman Catholic Vienna firm of booksellers, Frick, who have gone into publishing. Both of them take only books which they can introduce into Germany – a rather difficult and not very enviabie task.“
[15] Quellen: WILHELM MÜLLER, Wilhelm Frick. Zum 50jährigen Jubiläum. in: BC, 59. Jg., Nr. 43, 23. Oktober 1918, S. 496 f. Eine detailliertere Biographie Wilhelm Fricks findet sich mit Porträt im Vorspann zum Adreßbuch, 54. Jg., 1925. Siehe außerdem: Fünfundsiebzig Jahre Buchhandlung Wilhelm Frick. (Festschrift) Wien 1943.
[16] Siehe: Jahrbuch der Universal-Edition 1901-1976. 25 Jahre Neue Musik („Der Aufbau des Verlags“, S. 9) dieses Datum angegeben. Im Adreßbuch findet man: 15. Juni 1901. Dasselbe Datum findet man im Katalog 75 Jahre Universal-Edition. 1901-1976 zur Ausstellung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek 1976. Siehe vor allem die ausgezeichnete Würdigung „Die Universal-Edition“, in: Die Wage (Wien), XIV. Jg., Nr. 49, 9.12.1911, S. 1137-1140. (Teilabdruck in: BC, Nr. 52, 27.12.1911, S. 754f.)
[17] Nach dem soeben erwähnten Katalog.
[18] Siehe auch Anm. 58. „Jubiläen.“ (25 Jahre Verlag Josef Weinberger). In: BC, Nr. 42, 19. Oktober 1910, S. 595: „Im Jahre 1901 rief er die bekannte, inzwischen zu großer Bedeutung herangewachsene Universal-Edition, die einzige österreichische Klassikerausgabe, ins Leben.“
[19] So informativ der zitierte Katalog aus dem Jahre 1976 in manchen Hinsichten sein mag, es fehlt ihm eine gewisse Kontur, eine knapp gefaßte Würdigung der Bedeutung der Universal-Edition. So etwas kann nicht durch eine reichhaltige Exponatensammlung, ein unverbindliches Allerweltsvorwort und eine Anführung diverser Komponisten und Werke wettgemacht werden. Mit anderen Worten fehlt – was hier zumindest ansatzweise versucht wurde – ein Hinweis auf den Stellenwert in der damaligen musikverlegerischen Landschaft. In diesem Katalog ist z.B. vom Direktor Hugo Winter, der an die zwei Jahrzehnte lang mit der Firma verbunden war, als Aktionär wie als Kollektiv-Prokurist verbunden war, nirgendwo die Rede. Sucht man einen „Peter“ Winter, der einmal erwähnt wird, hat man etwas mehr Glück (S. 52). Wie aus den späteren Ausführungen über den Verlagsförderungsfonds hervorgehen wird, war die Universal-Edition der am meisten begünstigte Verlag Österreichs. Vertreter des Verlags war Hugo Winter (* 2.9.1885, Wien). Viele Aktionäre der U.E. waren nun einmal Juden, die – so sie noch lebten – enteignet wurden. Winter ist nur ein Beispiel.
[20] Nach einem Bericht über das 50-Jahr-Jubiläum von „Styria“ im März 1920 (BC, Nr. 10 u. 11, 17. März 1920, S. 129) erfolgte die Eröffnung am 1. März 1870. Daß Verlagsgeschichte nicht gerade die Stärke eines Verlages sein muß, beweist erneut „Styria“. Gemeint ist die Festschrift aus dem Jahre 1969: In Jahrzehnten gewachsen. Druck- und Verlagshaus Styria. Graz o.J. (1969). In einem Vermerk heißt es: „Dieses Buch wurde aus Anlaß des 100jährigen Jubiläums der Anstalten des Katholischen Preßvereins Graz-Seckau herausgegeben.“ In dem einzigen informativen Teil dieses bunt und schön gedruckten Werkes, der Zeittafel, heißt es entgegen unseren anderen Quellen: 1872 Gründung einer eigenen Verlagsbuchhandlung. Sonst ist diese Festschrift als Grundlage leider vollkommen wertlos. Informativer ist hingegen eine andere Publikation aus dem Jahre 1949, die von Dr. KARL MARIA STEPAN herausgegeben wurde. Sie heißt: Stückwerk im Spiegel. 1869-1949 Eine Jubiläumsschrift über katholische Arbeit für Zeitung und Buch in der Steiermark. „Es wurden 1.000 Exemplare dieses Buches, davon 100 numerierte, aufgelegt, die als Jubiläumsgabe bzw. in der Folge als Geschenk an Freunde des Hauses ausgegeben wurden. Im Handel war es nie erhältlich.“ (Frdl. Hinweis des Verlags Styria an den Verf. am 4.8.1983.) Eine Art Zusammenfassung dieser Publikation veröffentlichte STEPAN 1956 u.d.T.: Graz-Köln-Wien. Katholische Verlagsarbeit in der Steiermark, in: Die Furche (Wien), Worte in die Zeit, Nr. 24, 9.6.1954, S. 5f.
[21] „Jubiläum der Styria“. In: BC, 60. Jg., Nr. 10 u. 11, 17.3.1920, S. 129. Siehe auch Meyerhoff-Jubiläum, in: BC, 48. Jg., Nr. 2, 9.1.1907, S. 16 und „80 Jahre ‚Styria'“ in: Anzeiger, Nr. 21, 1.11.1949, S. 190.
[22] Quellen: „Jubiläum. Hofbuchhandlung Ulrich Moser.“ In: BC, 59. Jg., Nr. 141, 3.4.1918, S. 160; Nachruf Julius Meyerhoff, ebda., 62. Jg., Nr. 18-19, 4.5.1921, S. 151; Adreßbuch, 52. Jg., 1918, S. I mit Porträt.
[23] Siehe BC, 61, Jg., Nr. 16 u. 17, 28.4.1920, S. 206-207 bes. S. 206. Quellen: CARL JUNKER, Das Haus Gerold in Wien. 1775-1925. Wien: Gerold, 1925, S. 53-54; ders. Der Verlagsbuchhandel in der Republik Österreich. Sonderdruck aus Deutsche Verlegerzeitung, Nr. 22, 1921, S. 3f. HEINRICH SARTOR, zit. Anm. 4, S. 4; Weitere Literatur: Dr. ANNEMARIE MEINER, G. J. Manz. Person und Werk. 1830-1955. München/Dillingen, 1957, bes. S. 100-105 und Anmerkungen.
[24] Dieser Verlag gehörte wohl zu den erfolgreichsten der vielen Inflationsgründungen der jungen Republik und befaßte sich in erster Linie mit der Herausgabe fremdsprachiger Werke in der Originalsprache. Gegründet wurde er als Ges. m. b. H. von zwei bis dahin dem Buchhandel ferngestandenen Wiener Publizisten, darunter dem Schriftsteller Dr. Viktor Krakauer. Es hat zwei Produktionszweige gegeben: die „Bibliothèque Rhombus“ und die „Rhombus Edition“. Angeboten wurden u.a. Werke von Autoren wie de Musset, Balzac, Voltaire, Molière, Thackeray, Goldsmith, Longfellow usw. Die Produktion wurde folgendermaßen vorgestellt: „Den durch den Krieg verschütteten Weg zu den Geistesheroen der Menschen, zu ihren Dichtern und Denkern zurückzufinden und der Bevölkerung gute Bücher zu bringen, ist die Aufgabe unseres Verlages. Wir wollen es der großen Allgemeinheit ermöglichen, die besten Werke der besten Autoren in der Originalsprache zu erwerben und sich mit geringen Kosten Unterhaltung, Bildung und Belehrung zu verschaffen. (…) Unsere Sammlung enthält nicht nur die besten Werke der schöngeistigen Literatur (Dramen, Lyrik, Erzählungen und Romane), sondern auch die Hauptwerke volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Inhaltes und entspricht damit in hervorragendem Maße auch den Bedürfnissen der Schulen. Der Hauptvorzug unserer Bücher besteht in dem überaus niedrigen Preis, der auch für den notleidenden Mittelstand erschwinglich ist.“ (BC, 61. Jg., Nr. 23-25, 23.6.1920, S. 284-285; bes. S. 284.) Die rasante Teuerungsrate Anfang der 20er Jahre zwang die meisten Unternehmungen, ihre Kapitalsbasis zu verbreitern, so auch im Fall Rhombus. Am 15. 3. 1921 fand daher die konstituierende Generalversammlung der Rhombus-Verlagsaktiengesellschaft zwecks Fortführung und Erweiterung der bestehenden Ges. m.b. H. statt. Das Stammkapital wurde auf 18 Millionen Kronen erhöht (Österreichischer Buch- u. Steindrucker [Wien], XIV. Jg., Nr. 6, 25.3.1921, S. 45). Da das Kapital irgendwo aufgetrieben werden mußte, zeichneten wie so oft diverse Banken, die ihre Vertreter in den Verwaltungsrat entsandten und freilich weniger Interesse an der Vermittlung geistiger Werte und mehr Interesse an der verkaufbaren „Ware“ Buch und handfesten Dividenden hatten. Der Verwaltungsrat der Rhombus Verlags-AG ist daher auch typisch. Da saßen Branchenfremde wie der Direktor der Zentralbank der deutschen Sparkassen, der Verwaltungsrat der Vernay AG, der Gesellschafter des Bankhauses Lieben & Co. und kurzfristiger Ehemann der Tochter Franz Bleis, Ernst Lieben, und der Morgen-Herausgeber Maximilian Schreier u. a. Über die geschäftliche Entwicklung des Verlags schrieb der angesehene österreichische Volkswirt 1926 folgendes: „Während der Inflationszeit ermöglichten die billigen Gestehungskosten einen großen Absatz in den verschiedensten europäischen Staaten, insbesondere auch in Frankreich, Italien und Polen. Die französischen Bücher gingen größtenteils nach Frankreich. Der Zusammenbruch des französischen Franc anfangs 1924 machte der Konjunktur ein Ende. Der Export nach Frankreich hörte gänzlich auf und auch in den anderen Absatzgebieten konnten die französischen Verleger die Rhombus AG unterbieten.“ (Die Bilanzen. Beilage zum Österreichischen Volkswirt, [Wien], 18. Jahr, Nr. 51, 18.9.1926, S. 454.) Was nicht erwähnt wird und was zum Untergang des Verlags beigetragen haben muß, ist die Pleite u. a. der Zentralbank der deutschen Sparkassen. Die Rhombus AG stellte ihren Betrieb im Jahre 1926 – im Gegensatz zu den anderen Verlags-AG“s (Rikola, Wila) – ohne Verschuldung ein. Die Verwaltung entschloß sich in diesem Jahr zur Auflösung der Gesellschaft und zum Verkauf der Vorräte ,in Büchern, Platten usw. an die Hölder-Pichler-Tempsky AG, die die Bücher eben als Schulbücher verwendete. (Zur Auflösung siehe: FRIEDRICH SCHILLER, Vom Wiener Buchhandel. in: Börsenblatt, Nr. 222, 23.9.1926, S. 1158f; bes. S. 1159.) Noch im November 1926 hat die selbst in Auflösung begriffene Rikola AG den Vertrieb einer ganzen Reihe von Werken des Rhombus-Verlags übernommen (Anzeiger, Nr. 45, Jg. 1926, 5.11.1926, S. 305). Das Motiv hinter dem Verlagsnamen ist nicht bekannt. Weitere Literatur: WAZ, Nr. 12.775, Sa., 27.11.1920, S. 5 sowie JUNKER, Der Verlagsbuchhandel, zit. Anm. 77, S. 6.
[25] „Der Verlag will in erster Linie dazu beitragen, die im deutschen Österreich vorhandenen und wenig beachteten Kulturwerte im In- und Ausland bekannt zu machen; darüber hinaus will er der Wissenschaft und Kunst ohne Unterschied ihrer Heimat dienen, wenn nur immer sie geeignet ist, Bildung, Belehrung und sittliche Erhebung zu schaffen. Die Herausgabe volkstümlicher, besonders heimatkundlicher Schriften in guter Ausstattung steht an der Spitze seines Programmes.“ Werbetext in: BC, 62. Jg., Nr. 1, 26. Jänner 1921, S. 34-37; bes. S 34. Zu den verlegten Sammlungen gehörten „Österreichische Kunstbücher“, „Süddeutsche Kunstbücher“, „Kunst in Holland“, „Kunstwanderungen durch die Heimat“ usw. Quellen: CARL JUNKER, Der Verlagsbuchhandel, zit. Anm. 77, S. 4; „75jähriges Geschäftsjubiläum der Verlagsbuchhandlung Ed. Hölzel in Wien“, in: BC, 60. Jg., Nr. 42, 15. Oktober 1919, S. 617; Festnummer 1910, II. Teil, S. 47 f.
[26] Literatur: „Jubiläum der Firma Urban & Schwarzenberg in Wien“, in: BC, Nr. 48, 29.11.1916, S. 609 f.; Biographie Karl Urban im Adreßbuch, 57. Folge, 1930, S. V. Siehe auch den Jubiläumskatalog 1916 mit einer Einleitung über die Entwicklung der Firma sowie Festnummer 1910, II. Teil, S. 26 f.
[27] Die Informationen in dem nun folgenden geschichtlichen Umriß sind folgendem Werk entnommen: HANS SCHROTH, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung. 1894-1934. Eine Bibliographie. (Darin: ERNST K. HERLITZKA, Zur Geschichte der „Ersten Wiener Volksbuchhandlung“). Wien: Europa Verlag, 1977. (= Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung. Band 7). Zum Tode Ignaz Brands, siehe: BC, Nr. 21, 24. Mai 1916.
[28] Zu der bei Herlitzka angesprochenen Verbindung mit Hugo Heller (S. 12). Siehe Mitteilungen des Wiener Volksbildungsvereins, November 1908, und BC, Nr. 50, 9. Dezember 1908, S. 742 f. 1908 waren mehrere Aufsichtsratsmitglieder des Wiener Volksbildungsvereins der Buchhandlung Hugo Heller & Cie. als stille Teilhaber beigetreten.
[29] Quellen: Schreiben Moritz Perles an Carl Junker vom 21. November 1900 (Akt Gremium/Perles); BC, Nr. 10, 10.3.1909, S. 114 f.; Buchhändler-Correspondenz. Festnummer 1910, Teil, S. 24; Faltprospekt: „Zum fünfzigsten Gründungstage der Buchhandlung Moritz Perles“, 15. März 1869- 15. März 1919. (Gremium/Perles); „Fünfzigstes Jubiläum der Firma Moritz Perles“, In: WAZ, Nr. 12.268, 13.3.1919, S. 3; BC, Nr. 9, 28. Februar 1917, S. 93 f. (Nachruf; BC, Nr. 12, 19.3.1919, S. 160; Literarischer Almanach für 1920. Herausgegeben von der Buchhandlung Moritz Perles, S. 15-18 (Weihnachten 1919). Lexikon der deutschen Verlage, zit. Anm. 66, S. 320.
[30] In den 20er Jahren der Ersten Republik konnte das Adreßbuch zum großen Teil aus wirtschaftlichen Gründen nur mehr unregelmäßig erscheinen. Zwischen 1918 und 1938 kamen nur acht Jahrgänge heraus. Das letzte Adreßbuch erschien 1937.
[31] Um nur einige wenige zu nennen: Hugo Bettauer, Egon Friedell, Alfred Polgar, Friedrich Torberg, F. K. Ginzkey, Franz Blei, K. H. Strobl, E. Conte Corti, Stefan Großmann.
[32] AVA, BMfHuV, VVST, H 2138.
[33] Das waren die Firmen: Alois Reichmann (Buchhandlung und Antiquariat), Josef Kende, Richard Lányi, Moritz Perles, M. Breitenstein, C. W. Stern, Heinrich Saar. Auf die „Arisierung“ einiger dieser Firmen und das weitere Schicksal einiger „jüdischer“ Buchhändler kommen wir am Schluß dieser Arbeit noch ausführlich zu sprechen. Katzler wurde mit Urteil des Volksgerichts Wien vom 27. 4.1949, ZI. Vg 1 f Vr 5194/46- HV 40/47. (Siehe Wiener Zeitung, Nr. 133 vom 9.6.1949) zu 18 Monaten schweren Kerkers und zum Vermögensverfall verurteilt. Das von ihm in der Wiedner Hauptstraße geführte Buchhandelsunternehmen ging in das Eigentum der Republik Österreich über.
[34] Wie Anm. 86.
[35] Im Rahmen eines Rückstellungsverfahrens, das ja das Überleben eines ehemaligen jüdischen Inhabers bzw. von dessen Nachkommen zur Voraussetzung hatte und im Jahre 1949 vom ehemaligen Inhaber Oskar Perles angestrengt wurde (63 RK 20/49 vom 6.4.1949), wurden die gesamten ehemaligen Perles-Bestände eingestampft. Katzler verlor nach dem Verbotsgesetz „sein“ Eigentum.
[36] Entsprechende Fotos finden sich in: Moderne Ladenbauten. Außen- und Innenarchitektur. Berlin: Ernst Pollak (1928). Tafel 87: „Großes Schaufenster 1926“; Tafel 88: „Ausstellungsraum, Sitznische“, Wiener literarische Signale, Nr. 4, 1924, hinterer Umschlag („Bücherwurm“); Wiener literarische Signale, Nr. 3, 1924 (Umbau von Lichtblau); Ebenda, Winternummer 1929 (Schaufenster von Lichtblau).
[37] Zur Geschichte siehe u. a.: „Buch- und Kunstverlag Gerlach & Wiedling, Wien- 60 Jahre“, in: Anzeiger, Nr. 15, 9.4.32, S. 3 f.; Buchhändler-Correspondenz. Festnummer 1910, 1. Teil, S. 42. Siehe auch die Angaben in den folgenden Anmerkungen.
[38] Martin Gerlach wurde am 13. März 1846 in Hanau/Deutschland geboren.
[39] Schenk starb am 16. Februar 1916 in Dresden im Alter von 68 Jahren. (Siehe BC, Nr. 10, 8.3.1916, S. 104.) Das nach 1901 in seinem Verlag erschienene Werk „Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina und anderen Sammlungen“ galt als Monumentalwerk ersten Ranges.
[40] Albert Wiedling starb im Alter von 77 Jahren am 7. August 1923 in Munichstal-Ulrichskirchen, NÖ. (Siehe Anzeiger, Nr. 41, 17.8.1923, S. 388.) Zu seiner Biographie siehe BC, Nr. 23, 5. Juni 1907, S. 329.
[41] Wiedergabe von Illustrationen aus diesen Büchern siehe: Österreichs Illustrierte Zeitung (Wien), XV. Jg., So., 11. 3. 1906, Heft 24, S. 552-559.
[42] JOSEPH AUGUST LUX, Martin Gerlach. Zu dessen 60. Geburtstag. (Mit 37 Illustrationen.) In: Österreicbs Illustrierte Zeitung (Wien), ebda., S. 552-553.
[43] In diesem Zusammenhang sei auf die Verlags- und Kommissionsbuchhandlung Carl Konegen in Wien hingewiesen. Sie wurde am 1. Jänner 1877 von dem aus Braunsberg in Ostpreußen gebürtigen Buchhändler Carl Konegen (5.2.1842-23.1.1903) gegründet. Das erste Verlagswerk erschien im selben Jahr. Der Verlag Carl Konegen „umfaßte zuletzt (1917) über 500 Werke meist philosophischer, philologischer Literatur, darunter Arbeiten erstklassiger österreichischer Gelehrter, wie er überhaupt danach strebte, seinem Verlag einen ausgesprochen österreichischen Charakter zu geben“ (BC, Nr. 25, 20.6.1917, S. 278). im Jahre 1910 wurde der Grundstein zu Konegens Jugendschriften- und Bilderbücherverlag gelegt. Hieraus entstand u. a. die sehr beliebte, billige Reihe „Konegens Kinderbücher“, von denen bis Ende 1917 bereits 57 Bändchen (Preis pro Heft: 20 Heller) erschienen. Zu den Illustratoren dieser Serie gehörte K. A. Wilke. Die Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse gegen Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre führte dazu, daß der Schwiegersohn und Neffe Carl Konegens, Ernst Stülpnagel (Inhaber der Firma seit 1903) beim Handelsgericht in Wien den Ausgleich 1928 (Sa 33/28) und 1932 (Sa 463/32) anmelden mußte. Die Firma wurde am 12. Februar 1941 aus dem Handelsregister gelöscht. Quellen: Handelsgericht Wien. Register für Gesellschaftsfirmen, Bd. 56, pag. 131 und Register für Einzelfirmen, Bd. 39, pag. 162; Ausgleichsakten Sa 33/28 und Sa 463/32 (WrStLa); Der blaue Bücherkurier (Wien), XXXVII. Jg., Nr. 585, 15.11.26, S. 2; Anzeiger, Jg. 1927, Nr. 1, 7.1.27, S. 3.
[44] Gerlach starb am 9. April 1918 in Wien. Literatur zu seiner Person: JOS. AUG. LUX, zit. Anm. 96; Nachruf in: Österreichs Illustrierte Zeitung (Wien), 27. Jg., Heft 29,21. 4. 18, S. 512; BC, Nr. 11, 14.3.1906, S. 132; BC, Nr. 18, 1.5.1912, S. 258; Novitäten-Anzeiger (Wien), XXVIII. Jg., Nr. 501, 20.3.1916, S. 4.
[45] Siehe Anm. 94.
[46] Franz Gerlach wurde am 28. Jänner 1876 in Wien geboren und starb ebenda am 13. März 1952. (Siehe WZ, 14. 3. 1952)
[47] Walter Wiedling, von dem an späterer Stelle mehr-als die Rede sein wird, ist am 20. Jänner 1887 in Wien geboren worden. Er starb ebendort am 28. Oktober 1962. Zu seiner Biographie siehe WZ, 16.1.1957, S. 4; Rathaus Korrespondenz (Wien), 19.1.62, Bl. 101; Anzeiger, Jg. 97, Nr. 22, 15.11.1962, S. 128 (Nachruf).
[48] 75 Jahre Buch-, Kunst- und Musikalienverlag Gerlach & Wiedling, Wien. Wien o. J. (1948). Das „Geleitwort“ beinhaltet eine kurzgefaßte Firmengeschichte. Siehe auch: Berichte und Informationen, 2. Jg., Heft 56, 23.5.1947.
[49] Siehe Handelsgericht Wien. Register für Gesellschaftsfirmen, Band 53, Pagina 237, umgeschrieben nach Register HRA 8399.
[50] Zur Firmengeschichte siehe u. a. Festnummer 1910, II. Teil, S. 70 sowie Handelsgericht Wien. Register C, Band 17, Pagina 217, umgeschrieben nach Register HRB 4898. Siehe auch Anzeiger, Nr. 20, 15.10.1948, S. 4.
[51] Über diese Verlegerpersönlichkeit gibt es erwartungsgemäß die meiste Literatur, wie man sich eigentlich überhaupt bislang nur mit österreichischen Verlegern des 18. Jahrhunderts (Trattner, Joseph Kurzböck, Joseph Vinzenz Degen usw.) befaßt hat. Siehe u. a.: URSULA GIESE, Johann Thomas Edler von Trattner. Seine Bedeutung als Buchdrucker, Buchhändler und Herausgeber. Mit 15 Abb. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Band III, Sp. 1013-1454; auch phil. Diss. Wien 1959; HERMINE CLOETER, Johann Thomas Trattner-Ein Großunternehmer im Theresianischen Wien. Graz/Köln, 1952; FRIEDRICH SCHILLER, Gräffer und Trattnern. Zwei Buchhändler aus Alt-Wien. In: BC, Nr. 46, 12. 11. 1913, S. 628-630 (= Abdruck aus dem Deutschen Bibliophilenkalender für das Jahr 1914). Siehe auch die ausgezeichnete Arbeit von HERBERT ZEMAN: Der Drucker-Verleger Joseph Ritter von Kurzböck und seine Bedeutung für die österreichische Literatur des 18. Jahrhunderts. In: Die österreichische Literatur. Ihr Profil an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (1750-1830). Hrsg. von Herbert Zeman. Teil 1. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1979, S. 143-178 sowie WERNER M. BAUER, Die Verleger und Drucker Joseph Vinzenz Degen und Johann Baptist Wallishausser und ihre Stellung in der österreichischen Literatur ihrer Zeit. Ebda., S. 179-202.
[52] ANTON MAYER, Wiens Buchdrucker-Geschichte. Band II: 1782-1882. Wien 1887, S. 344. Zu Fromme siehe auch die kurzen Hinweise bei DURSTMÜLLER, zit. Anm. 2, S. 259.
[53] Carl (Ludwig Franz Wilhelm) Fromme ist am 24.8.1828 in Harburg a. d. Elbe geboren und am 28.9.1884 in Wien gestorben. Siehe: BC, 25. Jg., Nr. 40, 4.10.1884, S. 416 sowie ebenda, Nr. 41, 11.10.1884, S. 431-432. Otto Fromme ist am 19. August 1866 geboren und am 15. Juli 1921 gestorben. Siehe den Nachruf in: BC, 62. Jg., Nr. 28-30, 20.7.1921, S. 229.
[54] Siehe Anzeiger, 76. Jg., Nr. 23, 21.9.1935, S. 121.
[55] Siehe LUDWIG HEVESI, Neue Bilderkalender. In: Kunst und Kunsthandwerk, Jg. 10, 1907, S. 673-677.
[56] Siehe BC, Nr. 47, 23. 11. 1910, S. 703.
[57] Carl Georg Christian Fromme wurde am 25. 9. 1856 zu Niemburg an der Weser in Hannover geboren und ist am 21.5.1937 in Wien gestorben. Zu seiner Biographie siehe Anzeiger, Jg. 1926, Nr. 42, 15.10.1926, S. 279.
[58] Georg Wilhelm Otto Fromme ist am 16. 10. 1888 in Wien geboren. Als belasteter Nationalsozialist wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Geschäftsführung der von ihm Anfang der 40er Jahre gegründeten Firma ausgeschlossen. Die Firma konnte deshalb weiter existieren, weil die anderen Teilhaber der NSDAP nicht angehört hatten, so z.B. Christoph Reisser (31.7.1873, Wien – 13.1.1957, ebda.).
[59] Handelsgericht Wien. Register HRB 4898 (umgeschrieben von Reg. C 17, 217).
[60] Siehe die kurze Firmengeschichte in Festnummer 1910, II. Teil, S. 22; Anzeiger, Jg. 1926, Nr. 34, 20.8.1926, S. 205; Handelsgericht Wien. Register f. Einzelfirmen, Band 29, pag. 31 (am 21. Oktober 1939 nach Reg. HRA 4075 umgeschrieben. Die erste Eintragung erfolgte am 8. Februar 1889. Das Verlagssignet bestand – wie nicht anders zu erwarten – aus einem Mohrenkopf und einem stilisierten Körper mit den Buchstaben „RM“ und dem Wort „Durabo“. Eine etwas ausführlichere Geschichte dieses Verlags findet sich in der Broschüre 25 Jahre Wiener-Humor. Jubiläums-Katalog der Verlagsbuchhandlung Robert Mohr in Wien (1889-1914), S. 5-8. Die Broschüre enthält ein Verzeichnis der Verlagswerke bis 1914 zusammen mit Fotos der Verlagsautoren. (Original im Besitz von Werner J. Schweiger, Wien)
[61] Andere Beispiele unter den österreichischen Verlagen: der Verlag Josef Deubler und der am 1. August 1919 in Wien von Emil Engel gegründete „Nestroy-Verlag“ (nicht protokolliert).
[62] Siehe Anzeiger, Jg. 1927, Nr. 24, 17.6.1927, S. 150 und die Replik Mohrs, ebda., Nr. 26, 1.7.1927, S. 165 f.
[63] Anzeiger, 70. Jg., Nr. 8, 22.2.1929, S. 56; Anzeiger, Nr. 4, 15.2.1949, S. 35.
[64] Siehe Handelsgericht Wien. Registerakt HRA 4075 (umgeschrieben vom Register f. Einzelfirmen, Band 24, pag. 31). Robert (Arndt) Mohr, Sohn des Gründers, wurde am 6. Oktober 1890 in Wien geboren und starb ebendort am 22. November 1961.
[65] Siehe die Firmengeschichte von Halm & Goldmann in Festnummer 1910, II. Teil, S. 82.
[66] 13.11.1833, Wien-1.3.1916, ebda. Dazu der Nachruf in BC, Nr. 10, 8.3.1916, S. 104.
[67] Gestorben am 6. Februar 1932 im 60. Lebensjahr. Dazu der Nachruf auf Generalkonsul Hermann Gall. In: Anzeiger, 73. Jg., Nr. 7, 13.2.1932, S. 304.
[68] Auf Josef Kende (6.6.1868 – Oktober 1938) kommen wir in Zusammenhang mit der Verfolgung jüdischer Buchhändler und Verleger nach dem März 1938 ausführlich zu sprechen. Kende, der gleich nach seinem Ausscheiden aus der Firma Halm & Goldmann seit 17. Jänner 1933 eine Buchhandlung und ein Antiquariat in Wien führte, hatte damit die österreichische Auslieferungsstelle für praktisch alle Exil-, Emigrations- bzw. Anti-Nazi-Verlage.
[69] Die obigen Ausführungen beruhen auf dem Akt der Vermögensverkehrsstelle, Vermögensanmeldung (V.A.), Nr. 17.425 von Frau Elsa Gall im Bestand AVA, BMfHuV.
[70] Siehe Handelsgericht Wien. Register für Gesellschaftsfirmen, Band 45, Pagina 98 und Registerakt A 34, 158, umgeschrieben nach HRA 8404 (Handelsgericht Wien).
[71] Handelsgericht Wien. Register für Einzelfirmen, Band 13, Pagina 174. Vom Verf. gibt es zwei z.T. ausführlichere Arbeiten über den „Wiener Verlag“, und zwar: Verlage um Karl Kraus. In: Kraus-Hefte, Heft 26/27, Juli 1983, S. 2-31; bes. S. 12-15; sowie: Der “Törleß“- und “Reigen“-Verleger, in: Musil-Forum, 9 (1983).
[72] FRIEDRICH SCHILLER, Leopold Rosner. In: BC, Nr. 31, 29.7.1903, S. 463 f.; bes. S. 464. (Wiederabdruck in: Börsenblatt, Nr. 174, 30.7.1903, S. 5860. Siehe auch Börsenblatt, Nr. 172, 28.7.1903, S. 5820 sowie TH. EBNER, Erinnerungen an Leopold Rosner. In: ebda, Nr. 174, 30.7.1903, S. 5861. Zur Person Rosners siehe u.a. FRIEDRICH ARNOLD MAYER (Hrsg.), Aus den Papieren eines Wiener Verlegers. 1858-1897. Persönliches, Literarisches, Theatralisches. Wien/Leipzig: Braumüller 1908.
[73] Stern wurde am 22. August 1873 in Worms am Rhein geboren und führte ab 1912 unter seinem eigenen Namen, bis er 1938 gezwungen war, den Konkurs anzumelden, ein Antiquariat, eine Buchhandlung und einen Verlag. Über Sterns Schwierigkeiten mit Beschlagnahme und Zensur in Wien berichtet der Aufsatz des Verf.: Verlage um Karl Kraus (zit. Anm. 125), S. 14-15. Dazu auch Erotische Literatur. Zwei Verteidigungsreden gehalten von Dr. WALTER RODE. Wien und Leipzig: Buchhandlung L. Rosner Carl Wilhelm Stern, 1912, S. 14-28.
[74] Handelsgericht Wien. Register für Gesellschaftsfirmen, Band 49, pag. 27. Der Kommanditist Franz Ludwig Liebeskind war mit einer Vermögenseinlage von 14.000 Mark beteiligt, während Stern persönlich haftender Gesellschafter „zum Betriebe einer Buchhandlung in Wien“ war. Über Liebeskind scheint es eine Verbindung zum reichsdeutschen Verlag gegeben zu haben, genauer zum Verlag A. G. Liebeskind in Leipzig, der nach der Jahrhundertwende in den Besitz des Adolf Kröner Verlags in Stuttgart überging. Die zweite und letzte Eintragung unter Reg. Ges. Band 49, pag. 27, erfolgte erst am 20. September 1912, als die Firma infolge Gewerbezurücklegung gelöscht wurde. Es ist denkbar, daß Robert Musil u. a. deshalb mit seinem Törleß zum Wiener Verlag stieß, nachdem er 1901 mit dem Liebeskind Verlag in Deutschland korrespondiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt versuchte er nicht Törleß, sondern seine Paraphrasen an den Mann zu bringen. Die mögliche Verbindung bleibt eine reine Hypothese.
[75] 13.7.1872, Wien-3.11.1929, ebda. Zu seiner Biographie siehe Prominentenalmanach. Hrsg. von OSKAR FRIEDMANN. Wien/Leipzig: Verlag des Prominentenalmanachs, 1930, S. 80-81 und die Nachrufe u. a. in: WZ, 5.11.1929, S. 4 und NFP(A), 4.11.1929, S. 3.
[76] BRIGITTE REYHANI, Das literarische Profil des Wiener Verlages von 1899. phil. Diss. Graz 1971. Das Verdienst dieser Arbeit besteht in der ausführlichen Programmanalyse der Verlagsproduktion und im Hinweis auf die Bedeutung des Buchschmucks. Abgesehen davon, daß die Arbeit nur äußerst wenig zur Firmengeschichte beizutragen imstande ist – so bleiben z.B. die Umstände um die Einstellung des Verlags völlig unbekannt und ungeklärt -, beschränkt sie sich fast ausschließlich auf die Autopsie der Verlagswerke und zieht im günstigsten Fall außer Rezensionsabdrucken in einzelnen Verlagswerken nur noch Das literarische Echo als „Quellenmaterial“ heran.
[77] BC, Nr. 15, 13.4.1904, S. 231.
[78] Die dort angekündigten Neuerscheinungen sind dann nicht publiziert worden. Daß Freund dahintersteckte, kann freilich nicht mit absoluter Sicherheit behauptet werden.
[79] Bereits im Juli 1906 hatte Freund eine halbe Seite Anzeigenraum in der BC gekauft, um folgendes bekanntzumachen: „Den werten Herren Kollegen erlauben wir uns zur Kenntnis zu bringen, daß wir zu unserem bisherigen Verlagsgeschäfte nunmehr eine Druckerei größeren Umfanges käuflich erworben haben und offerieren wir Ihnen bei Bedarf die Herstellung von Prospekten, Verzeichnissen, Bureaupapiersorten zu den besten Bedingungen bei rascher und solidester Ausführung.“ (BC, Nr. 28, 11.7.1906, S. 413.)
[80] Willi Handl (1872-1920), der u. a. für die Anthologie „Variété“ dichtete und Übersetzungen aus dem Französischen machte, wurde in dieser Funktion bereits am 11. Jänner des folgenden Jahres aus dem Handelsregister gelöscht. Schließlich schob Freund Handl die Schuld für das finanzielle Desaster des Wiener Verlags zu.
[81] Handelsgericht Wien. Registerakt C 1, 34 (deponiert in WrStLa). Der Akt umfaßt 23 Seiten.
[82] BC, Nr. 7, 13. Februar 1907, S. 86; gekürzte Meldung im Börsenblatt, Nr. 40, 16. 2. 1907, S. 1831.
[83] Börsenblatt, Nr. 67, 21. 3. 1907, S. 3086-3087; bes. S. 3087.
[84] Die Zeit (Wien), 7. Jahr, Nr. 2020, Fr., 8.5.1908, S. 6-7. Weitere, meist gleichlautende Berichte über den Prozeß finden sich in: Illustriertes Wiener Extrablatt, Jg. 37, Nr. 127, 8. 5. 1908, S. 14; BC, Nr. 20, 13.5.1908, S. 276; Börsenblatt, Nr. 112, 15.5.1908, S. 5451; WZ, 8.5.1908; NWT, 8.5.1908, S. 12.
[85] Zum Prozeßverlauf siehe die diversen Berichte, Anm. 138.
[86] So entspricht die von Peter de Mendelssohn mehrfach in Zusammenhang mit Schnitzlers Reigen vertretene Ansicht, der Wiener Verlag sei „vertragsbrüchig“ gewesen, nicht ganz der Sachlage. Es war kein aktiver, sondern ein passiver Vorgang. Freilich war der Verlag insofern „vertragsbrüchig“, als es überhaupt keinen Geschäftsbetrieb mehr gab. (Siehe S. Fischer und sein Verlag. Frankfurt 1970, S. 442 und ders.: Zur Geschichte des “Reigen“, in: Almanach. Das sechsundsiebzigste Jahr. S. Fischer Verlag, 1962, S. 26.
[87] Siehe BC, Nr. 15, 12. April 1911, S. 191.
[88] Dies geschah mit Unterstützung der Gildemeester-Auswanderungs-Hilfsaktion ungefähr im Jänner 1939. Siehe den Akt Fritz Freund in AVA, BMfHuV, VVST, V. A. 40.602. Näheres zur Gildemeester-Aktion siehe die Ausführungen bei HERBERT ROSENKRANZ, Verfolgung und Selbstbehauptung. Die Juden in Österreich 1938-1945. Wien: Herold Verlag, 1978, S. 83f., 191f., 238f.) und JONNY MOSER, Die Katastrophe der Juden in Österreich 1938- 1945 – ihre Voraussetzungen und ihre Überwindung. In: Der gelbe Stern in Österreich. Katalog und Einführung zu einer Dokumentation. Eisenstadt: Edition Roetzer, 1977, S. 67-133; hier S. 122 f. (= Studia judaica austriaca V). Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Freund nach Österreich zurück, wo er am 8.5.1950 in Wien starb (frdl. Hinweis von Peter Braunwarth).
[89] Siehe Börsenblatt, Nr. 46, 25.2.1904, S. 1138.
[90] Der „Neudruck“ mit größerem Format – das 36.-40. Tsd. – erfolgte erst im Dezember 1908. Einige Schnitzler-Forscher vertreten, was die Auflagenhöhe des Reigen im Wiener Verlag betrifft, irrige Ansichten. So läßt Renate Wagner, die de Mendelssohns diesbezügliche mißverständliche Äußerungen übernimmt, Schnitzlers Reigen mit einer Startauflage von 27.000 Stück am 2. April 1903 erscheinen und die Auflage „im gleichen Jahr“ auf 40.000 klettern, was ein Unsinn ist. Die 40.000-Marke wurde, wie anfangs erwähnt, erst 5 1/2 Jahre später, im Dezember 1908, erreicht, als ein Neudruck veranstaltet wurde. Siehe dazu die entsprechende Anzeige in der BC, Nr. 49, 2.12.1908, S. 736 und RENATE WAGNER, Arthur Schnitzler. Eine Biographie. Wien: Molden, 1981, S. 143.
Ergänzungen zur Buchveröffentlichung von 1985
Neueste Forschungsliteratur
Zu Luigi Kasimir und der Firma Halm & Goldmann:
- Catherine Tessmar: Kistenweise Romantik. Kasimir und die Popularisierung des Wien-Bildes. In: Alt-Wien. Die Stadt, die niemals war. Hrsg. von Wolfgang Kos und Christian Rapp. Wien Museum – Czernin Verlag 2004, S. 250–257, sowie dies.: Wiener Platzerln. Die Geschäfte des Künstlers Luigi Kasimir. Wien: Czernin Verlag, 2006.
Moritz Perles:
- Murray G. Hall: Rühren an den Schlaf der Welt. In: Das jüdische Echo (Wien), Nummer 1, Vol. XXXV, Oktober 1986, S. 86-98.
- ders.: Epitaph auf den Verlag Moritz Perles in Wien, 1869–1938. Aus Anlaß des Todes seines Enkels, Paul S. Perles, am 9. Dezember 2001 in Northbrook, Illinois, U.S.A. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2002-1, S. 12–17.
- Daniela Punkl: Verlag Moritz Perles, k.u.k. Hofbuchhandlung in Wien. Diplomarbeit Univ. Wien 2002.
- Paul Perles: Looking Back. World History and Personal Recollections 1914-1994 (Northbrook, o.J.).
- Murray G. Hall: Julius Klinger und die Verlagsbuchhandlung Moritz Perles in Wien.
Carl Konegen Verlag:
Zur Berner Konvention:
Franz Gräffer:
Carl Fromme:
Anton Schroll:
- Der 100 Jahre-Almanach des Verlages Anton Schroll & Co. 1884-1984. Wien: Verlag Anton Schroll 1984.
Wilhelm Frick:
- Peter Fuhs: Fünf land- und forstwirtschaftliche Fachverlage. Ein Beitrag zum Verlagswesen in Österreich. Diplomarbeit Univ. Wien 1996.
- Murray G. Hall: 145 Jahre Wilhelm Frick in Wien. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2014-1, S. 57–70.
Manz:
- 150 Jahre Manz. Herausgegeben von der Manz GmbH. Redaktion: Franz Stein, Anton Hilscher. Wien: Manz 1999.
Wilhelm Braumüller:
Wiener Verlag (Sep.-Cto. L. Rosner):
- Sandra Schuschnigg: Der L. Rosner Verlag. Diplomarbeit Univ. Wien 1994.
Universal-Edition:
Styria Verlag:
- Matthias Opis: Eine unbekannte Größe. Die Unternehmensgeschichte der Styria Medien AG. Bericht über ein laufendes Projekt. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2006-2, S. 86–114.
Carl Wilhelm Stern:
- Marianne Fischer: Die erotische Literatur und das Gericht. Der Schmutzkampf zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien. Diss. Univ. Wien 1999. 1 (Gedruckt u.d.T.: Erotische Literatur vor Gericht. Der Schmutzliteraturkampf in Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts. Wien: Wilhelm Braumüller 2003.)
Deutscher Verlag für Jugend und Volk:
- Bernadette Natter: Der Deutsche Verlag für Jugend & Volk im Zeichen der österreichischen Schulreform. Zur Buchproduktion während der ersten großen Schaffensperiode von 1918–1938. Diplomarbeit Univ. Wien 2004.
- Murray G. Hall: Der Deutsche Verlag für Jugend und Volk 1938–1945. In: Harald Jele und Elmar Lenhart (Hrsg.): Literatur – Politik – Kritik. Beiträge zur Österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Göttingen: Wallstein 2014, S. 56–76.
- Bernhard Höglhammer: Mobilisierung für den Krieg: NS-Propaganda in ausgewählten Serien und Zeitschriften des Deutschen Verlags für Jugend und Volk. Diplomarbeit Univ. Wien 2015.
Hölder-Pichler-Tempsky:
- 200 Jahre Verlagsbuchhandlung Pichler. Wien: Pichler o.J. (1993).
- Günter Treffer: Drei Jahrhunderte für Schule und Wissenschaft: Der Verlag Hölder-Pichler-Tempsky und seine Vorgänger. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1990.
A. Hartleben:
Gerlach & Wiedling:
- Friedrich C. Heller: Gerlachs Jugendbücherei. In: Die Schiefertafel. Zeitschrift für historische Kinderbuchforschung, Jg. IV, Heft 3, Dezember 1981, S. 138–162.
- Zu „Gerlachs Jugendbücherei“ und generell zu allen österreichischen Verlagen, die Kinder- und Jugendbücher in diesem Zeitraum herausgaben, siehe Friedrich C. Heller in Die bunte Welt. Handbuch zum künstlerisch illustrierten Kinderbuch in Wien, 1890–1938. Wien: Brandstätter 2008.
Gerold:
- Ingrid Jeschke: Der Verlag Carl Gerold‘s Sohn. Diss. Wien 1990.
Ed. Hölzel:
- Ed. Hölzel 1844–1969. Zum 125jährigen Bestand des Hauses am 15. Oktober 1969. Wien: Ed. Hölzel 1969.
Illustrationen
Anton Schroll & Co. (L. W. Seidel):
- Ludwig Seidel
- Ludwig Wilhelm Seidel
- Geschäftsauslage L. W. Seidel
Verlags- und Kommissionsbuchhandlung Carl Konegen:
- Ernst Stülpnagel (Zeichnung von Alfred Gerstenbrand 1922)
Moritz Perles:
- Aufklärungsbücher anno 1921
- Perles Klinger Weihnachten 1926
- Perles Klinger Weihnachten 1929
- Literarischer Almanach für 1922
- Verlag Moritz Perles-Signet
- Aufklärungsbücher anno 1921
- Perles „Vom Lachen im Kriege“
- Perles Kochbuch
- Perles Zeitschriften-Raum Anzeige
Deutscher Verlag für Jugend und Volk:
- DVJV Anzeige 1932